Wenn es nichts Schwarz auf Weiß gibt, kann Hörensagen auch schon Bedeutung haben ...
Wer etwas vorgetragen bekommt, sollte ruhig nachtragen!
Es gibt böse Vorurteile über Autoren. "Das bisschen, was ich lese, kann ich mir auch selber schreiben!", lautet ein oft unterschobenes Zitat, das den geistigen Horizont von Schriftstellern karikiert - vom Bauchnabel bis zum Tellerrand. Andere haben angeblich nicht nur wenig gelesen, sondern schreiben dafür auch noch zu viel. Oder sie reden zu oft und zu lange darüber bis das Aufschreiben nicht mehr lohnt.
Alles natürlich ungerecht und frei erfunden. Andererseits mögen Leser oft gerade das an Autoren: Sie hören sie lieber als dass sie sie lesen. Sie wollen schon vorher wissen, was sie nachher gar nicht mehr im Buch nachlesen.
Wie auch immer. Lesungen und Vorträge stellen für Autoren mittlerweile eine wichtigere Einnahmequelle dar als das Buchgeschäft. Und die mediale Wirkung ist häufig größer. Zudem kann kein Marketing erreichen, was die persönliche Begegnung mit Lesern bewirkt, im guten wie im schlechten, beim Motivieren und beim Abtörnen.
Oft genug ist es sogar so, dass sich aus Veranstaltungen mit Publikum erst Konturen eines Buches herausschälen, Texte durch Anregungen und Kritik eine Richtung nehmen, die vorher anders geplant war.
Das Gespräch ist - wenn es schriftstellerisch weitergegeben wird - aber oft mehr als bloßes Hörensagen, auch wenn es mitunter nicht einmal erreicht, was mit dem Schwarzaufweiß-Nachlesen erhofft wird. Dieser Widerspruch muss beiderseits - bei Autoren und Lesern - ausgehalten werden.
Schließlich gibt es noch Themen, die zu sperrig für ein Buch sind oder gegen die sich ein Publikum (noch) sperrt. Sie können in Vorträgen und Lesungen erarbeitet werden.
Zu welcher Kategorie die nachfolgenden Vortragsthemen gehörten, mag jeder für sich im Stillen denken - oder die Vorträge nachlesen soweit sie in Anthologien, Dokumentationen und Zeitschriften veröffentlicht sind.
Dazu finden sich unten einige Hinweise:
Schwerpunktthemen
Vier Themen der jüngeren Zeit werden beispielhaft genannt. In den vergangenen Jahren lagen die Schwerpunkte oft anders. Mitte der Achtzigerjahre und nach der Wende Anfang der Neunzigerj war Bürgerbeteiligung ein stark nachgefragtes Thema kombiniert mit politikwissenschaftlicher Beratung. Allerdings waren zu Beginn der Neunziger und ein Jahrzehnt später immer wieder die Kriege im Irak und auf dem Balkan ein medien-kritisches Thema. In jüngster Zeit liegt ein Akzent auf der alltagsnahen Sprach- und Kommunikationskritik.
Regelmäßige Vorträge
Hier finden sich Hinweise zu Seminaren, die jedermann teils mehrmals jährlich zugänglich sind.
Tagungsleitungen
Konzepte und Kooperationen sind in Vorbereitung, hier werden jedoch nur beispielhaft vergangene Projekte genannt.
Einzelvorträge
Es sind akzentuierte Rückblicke auf 2000 bis 2007, die zwar unvollständig sind, aber die Themenbreite abstecken.
Hinweise auf noch länger zurückliegende Vorträge
Da die Vorträge selten aufgezeichnet wurden, muss die schriftliche Form danach genügen. Die meisten sind dokumentiert worden und finden sich in Schriftenreihen und Bibliotheken, die übers Internet leicht zu recherchieren sind. Hier werden einige Themen genannt, um mögliche Suchkategorien anzudeuten..
Vortragstexte
Hier finden Sie als weiterführende Beispiele drei Vorträge, die gekürzt und redigiert nachträglich gedruckt wurden. Sie drehen sich um das Thema "Ökonomie der Aufmerksamkeit" und damit die neuen Verkaufsstrategien der Medien wie Emotainment und die Rückkehr zu mythologischen Erzählweisen.
Schwerpunktthemen
Diese Themen werden derzeit als Vorträge, Seminare und Coachings angeboten und je nach Ort, Datum und Teilnehmerschaft paßgenau konturiert:
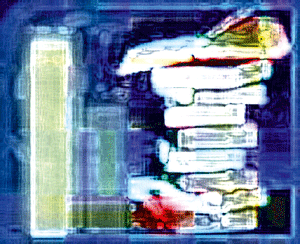 Aus-Zeiten Aus-Zeiten
Zwischen Just-in-Time und "Echtzeit" - Leben ohne Rhythmus?
Einführung ins persönliche und berufliche Zeit-Budgetieren ...
Die Vortragsreihe beruht auf dem Buch "Blitzkrieg gegen sich selbst". Näheres erfahren Sie hier.
Gänge durch die Geschichte.
Probleme der Präsentation, Repräsentation und Rezeption jüngerer deutscher Geschichte.
Ein Film und seine Perspektiven, eine Herausforderung und der Missbrauch von Erinnerungen und Denkmälern ... Näheres erfahren Sie hier. sowie in einer Reaktion hier.
Emotainment
Der 11.9. und der "Fall Sebnitz", Amokläufe und Bundestagswahlen.
Einführung in die Medienkritik ...
Der Bote als Verführer
Studien zum Sensationsjournalismus und seinen gesellschaftlichen Problemen.
Einführung in die Medienkritik ...
Wieder nach oben.
Regelmäßige Vorträge
Für angehende Sachbuchautoren werden regelmäßig Seminare mit einem Coaching-Programm im Evangelischen Medienbüro Hamburg und am Masterstudiengang Science Communication der Universität Bremen angeboten.
Wieder nach oben.
Tagungsleitungen
Es wurden eine Reihe von Tagungs- und Kongresskonzepten gemeinsam oder allein entwickelt, beispielsweise eine zehnteilige Diskussionsreihe für die Industriegewerkschaft Medien zur Wandlung der deutschen Presselandschaft Mitte der Neunziger Jahre oder Diskussionsabende zur Kulturpolitik in Norddeutschland mit allen deutschen Kultusministern (oder zur(Un-)Möglichkeit envon Kulturpolitik in oder mit den Gewerkschaft in der ver.di-Bundeszentrale Berlin am 17. Juli 2005).
Einige Kongresse haben dabei Tradition bekommen, so beispielsweise die Fachtagungen für die Kulturpolitische Gesellschaft "Rock & Pop - Gesellschaftspolitische Analysen und kulturpolitische Perspektiven" 1979 in Würzburg, 1989 in Düsseldorf und 1999 in Hamburg.
Wieder nach oben.
Einzelvorträge
Einige Vorträge in 2000
Das Buch der Bücher im Jahr 2000 - Bücher des Buchs? Spiegel Bibel: Mythen, archaische Erzählformen und Schicksalsfundus als Grundlage der Literatur?
>> Einführung ins Thema und Entwurf einer Lesereihe für Leipzig im Kulturamt Leipzig,am 22. März 2000
Perspektiven und Probleme des Technik-Journalismus(-Studiums).
Einführung ins Thema und Entwurf von praktischen Studien-Inhalten.
>> An der FH Bonn-Rhein-Sieg, Fachbereich Journalismus, am 12. April 2000
Doku-Drama als Inszenierungsform zwischen Authentizität und Manipulation.
Einführung ins Thema und Filmvorführung zu "Vier Wände. Eine deutsche Einheit".
>> An der Universität Hannover, Fachbereich Germanistik, am 09. Mai 2000
Probleme und Perspektiven des Wissenstranfers und der Internet-Präsentation von Hochschulen.
Einführung ins Thema und Kritik an Internet-Auftritt der Universität Dortmund in deren Rektorat, am 11. August 2000
Medien und Gedächtnis zwischen Authentizität und Inszenierung.
Öffentliche Erörterung mit Prof. Dr. Detlef Hoffmann im Rahmen der «Filiale für Erinnerung auf Zeit» (Hamburg vom 2.-6. September 2000)
>> In den Hamburger Kammerspielen, am 05. September 2000
Online-/offline- und leanback-/leanforward-Kommunikation.
Probleme, Paradoxien und Perspektiven des Internets.
Einführung in den Online-Journalismus.
>> An der Fachhochschule Hannover, Fachbereich Informations- und Kommunikationswesen, Journalistik und PR/Öffentlichkeitsarbeit, am 10. November 2000
"Mich gibt´s zweimal!"
Anmerkungen zu Verschiebungen des Verständnisses der Autoren.
Tagungseröffnungsgsvortrag und zum ersten Themenblock: "Das neue Deutschland und die Literatur. Beobachtungen und Reflexionen" auf der Tagung "Die Kraft der Literatur. Tradition und Wandel des literarischen Lebens im neuen Deutschland", >> In der Evangelischen Akademie Loccum, 24.-26. November 2000
BIG BROTHER als mediale Chiffre, 1948 - 2000.
Vom literarischen zum online-Bild - ein Spiegel der Medienentwicklung und gesellschaftlichen Deutung.
Einführung in die Medientheorie.
>> An der FH Bielefeld, Fachbereich Gestaltung, am 12. Dezember 2000
Einige Vorträge in 2001
BIG BROTHER als mediale Chiffre, 1948 - 2001.
Vom literarischen Bild zur Internet-Bilderflut zum online-Bild - wo liegt der Reiz?
Auf der Tagung "Das Fernsehen als Labor - Big Brother und die Veränderung der Medienlandschaft".
>> In der Evangelischen Akademie Hofgeismar, 16. Bis 18. Februar 2001
Der Text ist nicht der Text.
Textgestaltung zwischen Sub- und Meta-Texten, Konnotationen und links, Tonlage und sound.
Einführung in das Erzählen.
>> An der Fachhochschule Mainz, Fachbereich Design, am 08. Mai 2001
Einige Vorträge in 2002
"Kampagnen-Journalismus als Inszenierung und Infotainment. - Der "Fall Sebnitz" und die Folgen.
Einführung in Recherche und Reportage.
>> An der Universität Hannover, Fachbereich Germanistik, am 17. Januar 2002
"Hier werden Sie geholfen!" - Texten zwischen Schlichtheit, "Eindeutigkeit” und Intertextualität.
Einführung in das (werbende) Erzählen.
An der Fachhochschule Mainz, Fachbereich Design, am 27. Mai 2002
Geradeaus, rückwärts oder rückwärtsrückwärts. - Richtung, Rhythmus, Redundanz bei Textverdichtungen im Journalismus - Beispiel Nachrichten
Einführung in nicht-lineares Texten.
>> An der Fachhochschule Gelsenkirchen, Studiengang Medien & Technik-Kommunikation, am 20. Juni 2002
Große Freiheit und kleine Wirklichkeitssplitter. Doku-Show zwischen Sub- und Meta-Texten
Einführung in das filmische Erzählen.
>> In der Evangelischen Akademie Loccum auf der Fachtagung "Modelle der lokalen Bürgerbeteiligung”, am 11. Oktober 2002
Einige Vorträge in 2003:
Ein Film, "Das Sicherheitssyndrom", seine Annahmen und Folgen. Wie der "Faktor Mensch" im Fernsehen gefürchtet wurde.
I> In der Evangelischen Akademie Loccum auf der Fachtagung "Potentieller Versager oder Sicherheitsgarant? Der Faktor Mensch in industriellen Betriebsabläufen, am 13. März 2003
Der "Fall Sebnitz" - Kampagnenjournalismus und Möglichkeiten kommunaler Korrektur.
Einführung in lokale Öffentlichkeitsarbeit
>> Im Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanal Chemnitz (SAEK), Chemnitz am 28. April 2003 im Rahmen des Seminars "Krisenmanagement in der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit" (veranstaltet von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Dresden
Bauplanungen und Bürgerinitiativen - Verwaltung und Lokalpolitik zwischen Bürgerbeteiligung, Bürgerprotest und kommunaler Öffentlichkeit
Einführung in lokale Öffentlichkeitsarbeit.
>> Im Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanal Chemnitz (SAEK), Chemnitz am 28. April 2003 im Rahmen des Seminars "Krisenmanagement in der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit" (veranstaltet von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Dresden
Chiffrierung von Atomkriegsängsten in B-Filmen - Dekonstruktion und Projektion gesellschaftlicher Ängste in den USA, GB und Japan der fünfziger bis achtziger Jahre.
Einführung in das filmische Erzählen.
>> An der Universität Essen, Filmtagung der "Sektion Medien- und Kommunikationssoziologie" am Kulturwissenschaftlichen Institut, am 10. Mai 2003
Kriegsberichte zwischen breaking news und Mythologie - Der Dritte Golfkrieg und seine Erzählmuster.
Einführung in Grundlagen der aktuellen Kriegsberichterstattung.
>> An der Universität Hannover, Fachbereich Germanistik, am 03. Juli 2003
In 2004 und 2005 wurden wegen anderer Verpflichtungen keine Vortragseinladung angenommen.
Einige Vorträge in 2006
Merkmale der Sprache bei der Krisenberichterstattung.
Vortrag und Diskussion im "Seminar für Sicherheitspolitik 2006 – Modul 7"
>> An der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Berlin-Pankow am 21.05.2006
Blick in die "Vier Wände" durch die fünfte Wand.
Rückblende auf einen Fernsehfilm aus dem Jahr 1990.
>> Auf der Tagung "Diskursmauern – Aktuelle Aspekte der sprachlichen Verhältnisse zwischen Ost- und Westdeutschland"
Tagung der AG "Sprache in der Politik" an der Universität Greifswald vom 2. – 4. Oktober 2006
Einige Vorträge in 2007
Interessant, aber langweilig! - Warum kulturelle Netzwerke die Medien weniger ernst und die eigene Klientel kommunikativ wichtiger nehmen sollten ...
Ein Statement zur Entbehrlichkeit von Journalisten.
>> In der Abschlussrunde der Tagung "Kulturparlamente, Kulturnetze, Verbände – Zivilgesellschaftliche Akteure in der Kulturpolitik" in der Evangelischen Akademie Loccum vom 16. - 18. Februar 2007
Die Karriere "falscher Formen": "Da werden Sie geholfen!" – Fragen und Chancen einer alltagsnahen "Sprachkritik".
Eine Sammlung von Vorstellungen.
Vortrag auf der Tagung "Sprachkritik und Sprachkultur – Konzepte und Impulse für Wissenschaft und Öffentlichkeit"
>> An der Universität Greifswald, 29. März 2007
Wieder nach oben.
Frühere Vorträge
Da die oben genannten und andere Vorträge selten analog oder digital aufgezeichnet wurden, musste oft genug die schriftliche Form danach genügen. Die meisten der hier genannten Themen sind dokumentiert worden und finden sich in Schriftenreihen und Bibliotheken wieder, die übers Internet leicht zu recherchieren sind. Sie alle und ihre Fundorte hier zu nennen, würde zu weit führen.
Hier werden einige Themen beispielhaft genannt, um mögliche Suchkategorien anzudeuten.
Von der Schwierigkeit, gerade Vergangenes zu erinnern. Der Fernsehfilm "Vier Wände" über die "Bilder der Wende" und das Trennende beim Erkennen der Gemeinsamkeiten.
(In: "Wir sind ein Volk. Wir auch!"? – Wahrnehmungen und Wertungen unter Deutschen sieben Jahre nach der Vereinigung, hrsg. v. Fritz Erich Anhelm, Loccumer Protokolle 3/98, Loccum 1998, S. 30 - 43)
Die rasche Ent-Politisierung der "Politik im ARD-Fernsehen - "tagesthemen", "Doku-Dramen" und "Talkshows" zwischen Rekonstruktion und Konstruktion der Realität. Ein Zappen entlang der Zeitströmungen.
(In: Die Inszenierung von Politik in den Medien – Die Inszenierung von Politik für die Medien, hrsg. v. Jörg Calließ, Loccum 1998, S. 196-265)
Krieg in den Medien - Krieg der Medien? Über Macht, Zensur und Öffentlichkeit
(In: Surgery Strike - Über Zusammenhänge von Sprache, Krieg und Frieden; Loccumer Protokolle, 1992)
Öffentlichkeit als Waffe der Militärs und Militaristen. "Golfkrieg", Somalia und der "Balkankrieg" als Beispiele für eine neue, wandlungsfähige militaristische Informationsstrategie
(In: "Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit". Die Medien zwischen Kriegsberichterstattung und Friedensberichterstattung, hrsg. v. Jörg Calließ, Loccum 1997, S. 169-203).
Blick Richtung Bagdad - Die erste Wahrheit des Krieges ist das Opfer
(In: Kunst & Kultur, 10. Jahrgang Nr. 4/2003, Stuttgart 2003, S. 13 -14)
Tod und Theo in der Hölle der Allgegenwart - Von der Notwendigkeit der Öffentlichkeit gegen den Terrorismus
(In: Kunst & Kultur, 10. Jahrgang Nr. 2/2003, Stuttgart 2003, S. 17 -18)
Babylon Towers. Meditation über neue Mantren
(In: Kunst & Kultur, 08. Jahrgang Nr. 7/2001, Stuttgart 2001)
Nancy Davenport und der 9.11. – Photo-Realismus vs. "Echtzeit-News".
(In: Kunst nach dem Krieg, hrsg. V. Detlef Hoffmann, Loccum 2004, S. 169-201)
Wieder ganz nach oben.
Vortragstexte
 Hier können Sie redigierte und teils gekürzte Fassungen ursprünglicher Vorträge einmal nachlesen. Es sind drei Texte in engem thematischen Zusammenhang - nämlich, was eigentlich konkret unter der "Ökonomie der Öffentlichkeit " zu verstehen ist, von der Medienmacher so gerne reden. Hier können Sie redigierte und teils gekürzte Fassungen ursprünglicher Vorträge einmal nachlesen. Es sind drei Texte in engem thematischen Zusammenhang - nämlich, was eigentlich konkret unter der "Ökonomie der Öffentlichkeit " zu verstehen ist, von der Medienmacher so gerne reden.
Sie meinen auf ihre großsprecherische Art vereinfacht damit, was früher von Medienwissenschaftlern "Gatekeeper-Funktion" genannt wurde: Dass Medien die weltweite Wirklichkeit gewissermaßen vorsortieren, sie ordnen für den Hörer, Leser oder Seher, damit er nicht von all dem überfordert sei. - Tür zu und keiner kommt mehr rein, der Unglück bringt, außer man kann dabei zusehen.
Tatsächlich passiert inzwischen das Gegenteil: Die angebliche "Ökonomie" unterfordert ihre Rezipienten, indem sie in kürzester Zeit zuviel mitzuteilen vorgibt und sich dabei auf gröbste Erzählfäden oder Symboliken verläßt.
Babylon Towers. Meditation über neue Mantren
Der Vortrag befaßte sich mit der Medienberichterstattung am und nach dem "11.9." in 2001. Er versucht nachzuverfolgen, warum sich manche Redewendungen aus den ersten Minuten so lange hielten, obwohl sie keinerlei Substanz haben - und warum der Schrecken der Attentate gerade mit emotionalisierenden Medien falsch wahrgenommen wurde und wird ...
Blick Richtung Bagdad - Die erste Wahrheit des Krieges ist das Opfer
Entgegen des Schlagwortes "Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit" plädierte der Vortrag für eine realistische Betrachtung der Kriegsberichte, die die Zuschauer im Fernsehsessel und in der U-Bahn hinter den dicken roten Schlagzeilen allesamt zu Feldherren machte ...
Tod und Theo in der Hölle der Allgegenwart - Von der Notwendigkeit der Öffentlichkeit gegen den Terrorismus
Wie sehr die Medien unsere Alltagswahrnehmung verschoben hat - oder besser gesagt: verrückt - wurde in diesem Vortrag an scheinbar weit auseinanderliegenden Beispielen der Berichterstattung illusriert und abgewogen ...
Babylon Towers.
Meditation über neue Mantren
 Seit dem 11. September 2001 ist das Erzählen schwerer geworden. Seit dem 11. September 2001 ist das Erzählen schwerer geworden.
Aber die Geschichten sind unglaublicher. Die Sprache versiegt.
Aber der Redeschwall nimmt kein Ende.
Nichts ist mehr, wie es war. Nichts ist mehr, wie es war. Nichts ist mehr, wie es war.
Ein schlichter Satz. Seit dem 11. September hören wir ihn täglich. Wie ein Mantra. Als könne er verhindern, dass künftig entführte Passagierflugzeuge wie Bomben in Hochhäuser gesteuert werden. Er soll wohl auch der Trauer über die mörderischen Ereignisse Trost einhauchen. Doch dunkel wird er gesprochen, dräuend.
Nichts ist mehr, wie es war. Doch wie "war" es? Und was "ist" denn dort, wo nun "nichts" ist? Graben die New Yorker Feuerwehrmänner im Schutt des Ist und finden immer mehr Nichts?
Nichts ist mehr, wie es war. Ein Satz, der nur schlicht scheint. Wie alles, was seit dem 11. September mehr geraunt als gesagt wird.
Er ist doch nur allzu sehr vertraut. Wir kennen das Mantra. Ganze Generationen wurden mit jenem eingeständigen Seufzen gequält, dass alles irgendwie vergänglich sei, alles Änderungen weiche.
Doch so, wie "Nichts ist mehr, wie es war" nun teilnahmsvoll summt, ist der nackte Satz nicht mehr eine Verbeugung vor der Wirklichkeit des Lebens, sondern ihre Verneinung. Nichts ist mehr so, wie es war, ist plötzlich ein erzürnter Slogan gegen das Lebendige, gegen jegliche Änderung.
Das ist - als fast ritualisiertes "Andenken" an die Toten vom World Trade Center - nicht gerade angemessene, menschliche, sondern mehr mediale Trauer wie sie uns in ähnlichen Bildern beim Tod der Prinzessin begegnte: Es ist eine versteckte, zynische Botschaft einer steifen "Betroffenheit" wie das bigotte, unbeteiligte "Betroffensein" in der verordneten Schweigeminute beispielsweise auf der Frankfurter Buchmesse. Es ist zudem ein spätes Eingeständnis der verbreiteten Angst, vom Leben - also von Offenheit und Öffnung und Wachsen und Wandel - infiziert zu werden. Deshalb die Litanei: Nichts ist mehr so, wie es war.
Was aber "war"? Was "ist"? Und was ist der Unterschied zwischen beiden - übrigens selten präzisierten - Zuständen, die im sensationsheischenden Singsang irgendwo zwischen "Vergangenheit" und "Wirklichkeit" wie dumpfe Paukenschläge vor schlimmeren Nachrichten auf allen Kanälen scheinen?
Es ist nicht mehr herauszuhören, was war, was ist, was sein wird. Zwar sind uns all die zugestellten Stichworte und Sätze vertraut. Doch wie sie sich nun zu Geschichten fügen und die brüchige Wirklichkeit der fragenden, späten Moderne zu einer keine Zweifel mehr duldenden "Realität" betonieren, ist monströs.
Da "war" doch schon lange von den "Schurkenstaaten" (George Bush, Bill Clinton, George W. Bush) die Rede, von den fanatischen "Bestien" (Bild-Zeitung am 14. 9. 2001: "Terrorbestie: Wir wünschen Dir die ewige Hölle"), dem "Bösen" schlechthin und von den "Angriffen" auf die "zivilisierte Welt" (Gerhard Schröder). George W. Bush hatte seine Vorstellung von "Gerechtigkeit" und "Recht" oft genug als Provinzgouverneur wie ein Sheriff breit gekaut, wenn Gegner der Todesstrafe ihm Nachdenklichkeit und Gnade empfahlen. Und nun wird das "Recht" eben grenzenlos: "Infinite Justice" (so der erste US-Codename), so die "mission-line" (besser gesagt: der Missionierungs-Slogan) des bereits auf ein Jahrzehnt angelegten "Kriegs gegen den Terror" (Hamburger Morgenpost). Von der "uneingeschränkten Solidarität" (Gerhard Schröder) war in Deutschland auch schon oft genug die Rede, wenn jemand keine Parteien mehr zu kennen glaubte oder das "Winterhilfswerk" ankurbelte und den "totalen Krieg" forderte. An "kollaterale Schäden" bei "chirurgischen Eingriffen" mit sprengstärksten Bomben sind wir doch längst gewöhnt seit dem Irak-Bombardement, das bis heute schon zehn Jahre andauert, und seit dem Jugoslawien-Krieg, nach dem noch so gut wie nichts wiederaufgebaut wurde.
Das ist alles so, wie es schon vorher war. Anders "ist" nur, dass sich hinter denselben Wörtern ausgerechnet all jene Wandlungen verstecken, die eher dazu führen werden, dass nichts mehr so sein wird, wie es war, als dass alles bleiben würde und werden sollte, wie es war. Doch darüber redet keiner, der den "Terrorismus" (gleich als eine Art Gattungs- und Gesinnungsbegriff statt von Attentätern zu reden) als "irrational" abtut und mit Clusterbomben Dörfer, Krankenhäuser und Moscheen sprengt oder "Sicherheitspakete" (Otto Schily) schnürt, die über den Bürgern abgeworfen werden wie in Afghanistan die Carepakte mit Erdnüssen. Doch was ist dann noch "neu" seit dem 11. September, was hat sich geändert?
Diese und andere bekannte und eingeschliffene Wörter gruppieren sich nicht mehr wie "Kavalleriepferde beim Hornsignal", wie es Erhard Eppler, der Schüler von Gerhard Storz, in Anlehnung an George Orwell analysierte. Wenn "sich" solche Schlachtrösser ehemals ins "politische Kampfgetümmel stürzten, wurden Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit von Politikern und Nichtpolitikern zu Opfern". Nun ordnen sie nicht, sondern chaotisieren die Gefühle noch weiter.
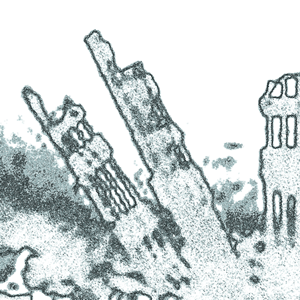 Sie sind auch kein Surrogat mehr für verloren gegangenen Sinn oder gar wie Lego-Bausteine zu einer "neuen" Weltordnung, so wie es Uwe Pörksen mit seinen "Plastikwörtern" als "Sprache einer internationalen Diktatur" prognostizierte. Nein, sie fügen sich nicht einmal mehr zu einem gängigen "Jargon der Eigentlichkeit", den Theodor W. Adorno nach den letzten Kriegen bei den Deutschen erkannte. Sie sind auch kein Surrogat mehr für verloren gegangenen Sinn oder gar wie Lego-Bausteine zu einer "neuen" Weltordnung, so wie es Uwe Pörksen mit seinen "Plastikwörtern" als "Sprache einer internationalen Diktatur" prognostizierte. Nein, sie fügen sich nicht einmal mehr zu einem gängigen "Jargon der Eigentlichkeit", den Theodor W. Adorno nach den letzten Kriegen bei den Deutschen erkannte.
Das geradezu Wunderliche und Bedrohliche ist die scheinbar grenzenlose Profanität jener Prosa, die uns im Staub der Twin Towers den letzten Blick für die Wirklichkeit nimmt. Sie ist weder "neu", noch ist sie "nichts" - sie klingt einfach nur. Und ihr Flageolett formt mit ungelenkem und dick aufgetragenen Pathos einen Klang von Wahrheit und Wahrhaftigkeit, den Orwell nicht einmal in seinen Alpträumen vom Big Brother und seinem Ministry of Truth komponieren konnte.
Denn das von totalitären Herrschern gefürchtete und mit dem "Neusprech" bekämpfte "Doppeldenken" der Untertanen scheint bereits - auch ohne ein "Wahrheitsministerium", nur mit der beschworenen Vielfalt der Medien - sprachlich schon nicht mehr möglich.
Nicht einmal mehr eine unfreiwillige Doppelbödigkeit wird in der heutigen Konstruktion von "Wahrheit", die Kriege rechtfertigt, wahr genommen: "Infinite Justice" wird frag- und kritiklos als "grenzenlose Gerechtigkeit" verstanden, obwohl es genauso gut "unbestimmte" und "endlose" Gerechtigkeit bedeutet, was weit weniger vertrauenerweckend wäre, nämlich wie das verplappernde Versprechen schmieriger Gebrauchtwagenhändler klänge. Als George W. Bush die "Schurken" in ihren "Löcher" und "Höhlen" aufzuscheuchen drohte, wurde sein stiernackiges "We make them run" stets ganz treu dumm übersetzt mit "Wir werden denen Beine machen". Aber "to make run" heißt auch, dass man etwas ins Laufen, zum Funktionieren bringt. Diese ungewollten Ambivalenzen sind in der empörten Rede verebbt, während drastische Ausdrücke wie "air campaign" (Donald Rumsfeld) schlicht mit "Luftangriffe" eingedeutscht wurde. Nicht ohne Grund, nicht ohne Hintergrund.
Gewiss, manches von dem, was Gerhard Storz, Dolf Sternberger und W. E. Süskind "Aus dem Wörterbuch des Unmenschen" den Deutschen ins Schulheft der jungen Demokratie schrieben, ist im heutigen Sprachgewitter wiederzuerkennen: Die unnütze, aber pathetitisierende Substantivierung, die radebrechende Miss- und Neubildung von Wörtern oder deren Umdeutung wie beispielsweise derzeit mit dem ehemals hehren, gewerkschaftlichen Begriff der "Solidarität", der nun eher todeswütig an die metaphorische "Nibelungentreue" anknüpft. Auch ist die emotionale Aufladung von Wörtern ähnlich wie im Fall des vormals beispielsweise von Norbert Elias kultur- und zeitkritisch gefassten Begriffs "Zivilisation" zu beobachten, die plötzlich sogar von eigensüchtigen Staatspräsidenten wie Silvio Berlusconi dreist und stolz mit "Überlegenheit" gleichgesetzt wird. Andererseits sind ohnehin stark besetzte Begriffe wie das Adjektiv "heilig" durch die Überhöhungsinflation keineswegs geschwächt. Dabei ist doch nichts mehr "heilig" seit alles heilig ist, besonders die eigene mörderische Sache.
Anderes im publizistischen Geschützdonner erinnert an die gestelzten Satzkonstruktionen, die Victor Klemperer als "Sprache des dritten Reiches - LTI" entblößte, um in seinem feinnervigen "Notizbuch eines Philologen" das verdeckte Anknüpfen an Vorurteile, den selbstvergessenen Hang zum Superlativischen und andererseits zum kruden Elenden bloßzulegen. Es ist ja nur zu leicht, mit den bekannten "Tarnkappenbombern" über "Bergziegen-Hirten" (Peter Scholl-Latour) zu kommen wie das Jüngste Gericht, das ewige Wahrheit und Recht bringt - man muss die Ungleichheit nur unvergleichlich in Höhen und Weihen preisen zu einer heldischen Großtat, die allseitig Applaus findet.
Und doch stehen die "neuen", altbekannten Sprachfetzen nicht in solcher Tradition des Gesprochenen, schon gar nicht des Geschriebenen, wie die zitierten Sprachkritiker sie bisher ausmachten. Welcher junge, friedensbewegte Mensch, der heute bei den Grünen für den "Krieg gegen den Terror" (Hamburger Morgenpost) eintritt, hat denn noch die elterlichen Reden von den "Elitesoldaten" im Ohr? Welcher Jungsozialist, der sich in seiner Partei nun auf der Seite des "Kampfes gegen die Feinde der Freiheit" sieht, wie er bizarrer zugespitzt nicht daherkommen könnte als auf der Internet-Page aus Bad Bevensen, kennt überhaupt noch den Begriff "Heimatfront", wie er sogar im sonst gemäßigten ARD-Weltspiegel auftauchte?
Gleichwohl galoppieren solche alten Rhetorik-Rösser ernst schnaubend durch Nachrichten und Parlamentsreden als würde der Kampf gegen den "Akt der Niedertracht" (www.britischebotschaft.de) nicht mit High Tech, sondern mit Lanzen ausgetragen wie in längst vergessenen abendländischen "Kreuzzügen", von denen die US-Baptist Church und die amerikanischen Bischöfe schon reden.
Es klingt vielmehr, als sei das stammelige Sammelsurium aus Satz- und Sprachstückchen eingeübt. Diese auch in Stil und Duktus kaum zu ordnende Raserei, zwischen Säbelrasseln und Technokratenüberheblichkeit schwankend mit einem lauten Schuss Stammtischbruderschaft und Machismo, nicht im Leben, nicht in der Schule und nicht im Elternhaus, sondern in den Werbeblöcken zwischen den Endlosserien als Actionfilm trainiert: "Come in and find out" als nassforsches Motto für die Afghanistan-Invasion; "Mission Impossible" als konditionierender Soundtrack für Bombardierungen und den befohlenen politischen Mord an Verdächtigten.
Die derzeitigen Nachrichtenshows mit ihren grellen Werbe-Jingles und Wichtig-Wichtig-Fanfaren und einem Minimum an Information und Aussage (von Wissen ganz zu schweigen), sind von den Trailern zu den üblichen Kriegs- und Action-Serien nicht mehr zu unterscheiden.
Aus ihnen sind auch die Titelzeilen für das Geschehen entlehnt. Das Genitivische regt sich überall fast phallisch: "Die Stunde des Präsidenten" (ARD-Brennpunkt), "Die Nacht der Helden" über die Bergungsarbeiten in New York. Nichts ist mehr einfach nur für sich - selbst das Sterben nicht. Es wird wieder für eine "gute Sache" (George W. Bush) wie die ersten beiden GIs oder für den Jihad gestorben.
Das Fernsehen bringt uns nicht erst seit dem 11. September auch mit solchen Rubrizierungen, Einordnungen, nahe, was der abwechslungslose Alltag, wo alles bleibt, wie es war, unser Alltag jenseits von Anschlägen und Krieg sonst nicht ist: Es macht das Befürchtete, das kribbelnd erhoffte Hereinbrechen des Unfassbaren, zum dauernden Programm. Es gibt nur wenige Ausnahmen in ARD und ZDF, gründlich recherchiert zu berichten. Und nicht in Emotionen aufgelöst, an alles zu glauben und es ungeprüft weiter zu transportieren, fällt inzwischen anscheinend immer schwerer. Die Journalisten Burkhard Schröder im "Tagesspiegel" und Frank Patalons im "Spiegel" mussten sogar daran gemahnen, dass sogenannte "hoaxes" den Schrecken als Grundlage gezielter Falschmeldungen und lustvoller Spekulationen nehmen.
Ansonsten Business as usual. Kurz nach den Anschlägen vom September-Dienstag - übrigens der Jahrestag des Militärputsches, den der CIA in Chile gegen die gewählte Allende-Regierung angezettelt hatte - standen beispielsweise folgende Titel auf den gewöhnlichen Abend-Programmen der privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten:"Das große Inferno", "Höllenjagd", "Der Code des Killers" (SAT.1), "Assasins - Die Killer" (RTL2), "Extremsportler(1)" (Phoenix), "Erdbeben in New York" (Vox), "Beim Sterben ist jeder der Erste" und "American Fighter V" (Kabel 1). Diese bizarre Mischung aus Extremen, Lust am Morden und dem Terror der Ängste und Gefühle wurde nur kurzzeitig abgeändert, weil die alltägliche Sichtung des Schreckens ausgerechnet mit der Wirklichkeit zusammengeprallt war.
Eben dieses rüde Ahistorische (trotz des mitklingenden, vermeintlich großen weltgeschichtlichen Auftrages in Afghanistan), eben das offen naive Untradierte (trotz der erkennbaren Tradition), die ungenierte Indienstnahme des Politischen durch das schwadronierende Pathos und süßliche sowie martialische Aufladung des Schlichten prallte aufeinander. Wo doch Vernunft die einzige Antwort auf emotionsgetriebenen Terror sein müsste, tritt das "neue" und gefährlichere Kauderwelsch auf, dem es nun nicht länger um eine Verständlichkeit oder Verständigung zwischen diesen genannten und bekannten Polen geht, sondern einvernehmende, emotionale Codes auf einem minimalen und zugleich möglichst breiten Niveau zu erzielen; Emotainment statt des sattsam bekannten Infotainment.
Dabei geht allerdings die Selbstvergewisserung durch eine allgemein verständliche Sprache zunehmend verloren. Man versteht vom Boden der Sprachgewohnheiten schon nicht mehr, was gesagt wird, allenfalls ahnt man es. Und wer sich noch erinnern kann im künstlich die ganze Erde aufheizenden Orkan der Echtzeit, die plötzlich pathetisch als "In Zeiten von Diesem und Jenem" etikettiert wird, ahnt es sogar dunkel.
Aber es fühlt sich irgendwie auch dumpf gut an, was im Dunkeln und im Scheinwerferlicht gemunkelt wird über unheimliche Mächte des Bösen. Überall lauert es, an allem ist es schuld. Das Erzählen mag bei der derzeitigen Sprachwirrnis schwierig geworden sein. Aber die Geschichten werden dadurch noch unglaublicher als sie bisher mit guter Absicht phantasiert wurden. Sie brauchen auch gar nicht mehr traditionell erzählt zu werden wie ein Roman, sondern kommen - anders als in jener globalen Lego-Bauwelt, die Pörksen vorhersah - mit globalisiertem Bruch wie "Solidarity" (Motto der Berliner Trauerdemo) aus, mit Labels wie "Infinite Justice" und nationalem und internationalisierten Versatz wie "Heimatschutz" (neu geschaffene US-Behörde). Der Mörtel der Plakativität im Gemisch mit klebriger Emotion hält unglaubliche Schichtungen, die weit in den Himmel reichen wie einst die Twin Towers. Wer Amerika und seinen Lebensstil wirklich noch mehr hasst als sich selbst, der hätte ja besser die Traumfabriken Hollywoods vernichten müssen, in denen die Twin Towers längst zerstört waren.
 Nichts ist mehr, wie es wahr war, weil die Sicht auf Wirklichkeit nicht durch die Anschläge, sondern durch ihre nachträgliche Deutung verschoben wurde - weil sie anders, nämlich inszenierter, gesehen wurden, als sie in ihrer widerwärtig grobschlächtigen Art waren. Es war kein "Kunstwerk", wie es der quälerische Dirigent Karl-Heinz Stockhausen stilisierte. Und es war auch nicht, was ein deutscher General (der erste, der eine NATO-Mission bei Auslandseinsätzen befehligt) meinte: Er habe die Bilder vom Sturz der Flugzeuge ins World Trade Center zunächst "für Science Fiction gehalten". Arme Ermordete. Ihr Tod als Kompositionsteil oder Komparsenschicksal. Aber es ist weder "science", auch wenn einige der Terroristen mutmaßlich Naturwissenschaften studierten. Noch ist es Fiktion, sondern elende Wirklichkeit. Wäre diese Story der Anschläge nämlich als fiktiver Thriller in Drehbuchform angeboten worden - jeder Produzent und erst recht die behäbigen Redakteure hätten sich krumm gelacht. Da sollen Studenten aus Hamburg-Harburg Flugstunden nehmen und danach mit entführten Passagiermaschinen Hochhäuser rammen? Völlig absurd. Solche Scheiße würde keiner sehen wollen. Nichts ist mehr, wie es wahr war, weil die Sicht auf Wirklichkeit nicht durch die Anschläge, sondern durch ihre nachträgliche Deutung verschoben wurde - weil sie anders, nämlich inszenierter, gesehen wurden, als sie in ihrer widerwärtig grobschlächtigen Art waren. Es war kein "Kunstwerk", wie es der quälerische Dirigent Karl-Heinz Stockhausen stilisierte. Und es war auch nicht, was ein deutscher General (der erste, der eine NATO-Mission bei Auslandseinsätzen befehligt) meinte: Er habe die Bilder vom Sturz der Flugzeuge ins World Trade Center zunächst "für Science Fiction gehalten". Arme Ermordete. Ihr Tod als Kompositionsteil oder Komparsenschicksal. Aber es ist weder "science", auch wenn einige der Terroristen mutmaßlich Naturwissenschaften studierten. Noch ist es Fiktion, sondern elende Wirklichkeit. Wäre diese Story der Anschläge nämlich als fiktiver Thriller in Drehbuchform angeboten worden - jeder Produzent und erst recht die behäbigen Redakteure hätten sich krumm gelacht. Da sollen Studenten aus Hamburg-Harburg Flugstunden nehmen und danach mit entführten Passagiermaschinen Hochhäuser rammen? Völlig absurd. Solche Scheiße würde keiner sehen wollen.
Aber leider wahr. Und alle wollten es sehen, immer und immer wieder. Nichts war, wie es wurde. Die "Realität" wird ausgerechnet von denen weithin überschätzt, die nichts (mehr) von der Wirklich- und Vergänglichkeit wissen wollen und die dann die Gegenwart plötzlich nur noch für fiction halten können. Es wird mit dieser Verschiebung auch immer schlimmer: Die Bilder, die beim Erzählen früher hinter dem Auge erst im Kopf entstanden, sind jetzt im Fernsehen zu sehen, live und in "Echtzeit". Aber sie kommen nicht mehr im Kopf an. Deshalb muss rumgeredet werden, damit die Bilder wie die Flugzeuge in die Twin Towers eindringen in die Seele. Der Soziologe Ulrich Beck charakterisierte in "Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne" schon 1986, was sich 2001 in New York erfüllte: "Wo der Überfluss an Risiken den Überfluss an Reichtum bei weitem in den Schatten stellt, gewinnt die scheinbar harmlose Unterscheidung zwischen Risiken und Wahrnehmung der Risiken an Bedeutung." (S. 76) Die New Yorker Künstlerin Nancy Davenport hat diese Bedeutung gesucht, indem sie in Fotos von Skylines amerikanischer Großstädte bedrohliche Rauchsäulen einkopierte. Doch diese Rauchzeichen verstanden nur wenige.
Was tragen denn die elektronischen Medien schon noch dazu bei, dass wir Wahrnehmung und Realität unterscheiden könnten? Sie haben am 11. September mit ihrem Bramarbasieren und Zeitlupenbildern von Menschen, die in ihrer Panik aus Fenstern springen, von der Endlos-Schleife der einschlagenden Maschine wie eine Video-Tapete phantastisch verdient. Es gab "Sonderausgaben" und "Sondersendungen" ohne Unterlass, "breaking news" und "special reports". Nur Informationen nicht - und kein Verstehen.
Doch eines wurde plötzlich und unerwartet sicher: Die Politik ist (selbst für Nicht-Wähler und Parteien-Verächter), ja die Welt ist insgesamt dadurch wieder einfach geworden. Nicht nur, dass die Risiken "sichtbar" geworden sind, auch ihre Wahrnehmung ist ungeniert durchsichtig geworden. Die "Risiken" erstehen auch ständig dank des News-Prasselns immer wieder "neu": Wie eine Mahr im Tagtraum. Die "Risikogesellschaft" mutierte zum irrwischigen Risiko.
Der Echtzeit-Terror der "News", des stilisierten "Neuen", kennt keine Vergangenheit. Nur deshalb ist nichts mehr so, wie es war: Weil kaum jemand mehr weiß, wie es war. Die Echtzeit kennt nur noch die Gegenwart, in der nichts mehr so ist, wie es ist - alles wird nur noch so "wahr" genommen, wie es gerade medial vermittelt wird. Die Twin Towers sind in Filmen und Computerspielen schon hunderte Male explodiert, verbrannt und zusammengestürzt. Jetzt, nachdem geschehen ist, was Jugendliche längst zuhause genossen und gespielt haben, sind diese Filme und Videospiele Lieblings-Leihartikel, die wahre Katastrophe wird Kult. Die "Spaßgesellschaft" reitet die kühnsten Attacken. Ihr Ende, von Peter Scholl-Latour trotzig ausgerufen, ist noch lange nicht gekommen, wie das die "Nichts ist mehr"-Prediger gerne hätten. - Nichts ist mehr, wie es war, weil alles so ist, wie es war.
Der Turm Babylon ist mit den Twin Towers in sich zusammengestürzt und hat auch kriegslüsternen Sprachschutt hinterlassen. Die letzten Funken Hoffnung auf Wahrhaftigkeit sind verschüttet. Die Realbilder der Twin Towers aber bieten nun die Chance, darüber zu reden, warum die perfektionierten Alptraumbilder lange vorher Konjunktur hatten und warum ihre wirkliche Zerstörung mutmaßlich für junge, gebildete Männer zum Lebenstraum wurde.
(In: Kunst & Kultur, 08. Jahrgang Nr. 7/2001, Stuttgart 2001). Sie finden diesen Vortragstext auch in stark erweiterter essayistischer Form in "Nirwana der Nichtse. Ortskunde" (Berlin 2005). Dazu finden Sie hier weitere Informationen.
Wieder nach oben.
Blick Richtung Bagdad
Die erste Wahrheit des Krieges ist das Opfer
 Das war also der Krieg? Wieder einer, den man schon lange kommen sah. Das war also der Krieg? Wieder einer, den man schon lange kommen sah.
Wie in Zeitlupe marschierten Truppen auf. Wieder so ein Krieg, den man gar nicht lange genug sehen konnte, so kurz er auch – bitteschön – sein sollte. Dennoch reihten sich die Nachrichten- und die Sonder- und die Nachrichtensonder-Sendungen aneinander zur Dauerfernsehsendung. Ja, es gab einen weiteren Irakkrieg.
Doch was haben wir da gesehen? Überwiegend nichts. Gibt es Grausameres? Wir kennen durch zahlreiche Reportagen allüberall nun den Alltag von allen möglichen Soldaten auf allen möglichen Flugzeugträgern der US-Navy. Sie beteten. Sie spielten Basketball. Sie sangen Gospels im Hangar. Sie schrieben an die Lieben. Sie schliefen unter Deck. Wir wissen jetzt auch, dass amerikanische Frauen um ihre Männer fürchteten. Mütter sorgten sich um ihre eingezogenen Söhne. Väter, die in Vietnam oder im Zweiten Golfkrieg eingesetzt waren, um „die Freiheit" zu verteidigen, erinnerten ihre Kinder, die wieder in den Krieg zogen. Manche hängten gelbe Schleifen als Zeichen für die Fortgegangenen auf. Kinder malten Bilder für ihre Mütter, die als Soldatinnen abkommandiert wurden.
War das schon Krieg? Es gab später sogar einige Tote zwischen Trümmern zu sehen. Im Irak. Am Schluss riss ein Panzer eine Saddam-Statue vom Sockel. "Sieg", lautete der Tenor in den Medien. Wie der Krieg ansonsten war, werden wir nie erfahren. Das wurde uns nebenher erklärt. Denn alle Medien seien "eingebettet" in die „Strategie der Militärs", hieß es so oder ähnlich. Welche Bilder wir sähen, entschieden letztlich jene. Selbst Bilder, die sonstwie dennoch auf unsere Schirme gelangten, zeigten nicht das wahre Ausmaß der Auseinandersetzungen. Die Wahrheit sei eben das "erste Opfer des Krieges". Achselzuckend repetierten Journalisten und Politiker dieses Bonmots des US-Senators Hiram Johnson von 1917. Inzwischen scheint es geradezu Militärund Medien-Doktrin geworden zu sein.
 Als ginge es im Krieg um Wahrheit! Als würden Bomben nicht Menschen töten, sondern Worte und Bilder. Es ist alles Lüge. Aber anders als wir es erklärt bekommen haben. Wir selbst sind Teil der Lüge. Als ginge es im Krieg um Wahrheit! Als würden Bomben nicht Menschen töten, sondern Worte und Bilder. Es ist alles Lüge. Aber anders als wir es erklärt bekommen haben. Wir selbst sind Teil der Lüge.
Der Dritte Golfkrieg hat die Welt verändert, weil er die Ansicht des Krieges verändert hat. Krieg ist nicht nur jederzeit und entgegen der demokratischen Regeln der Weltgemeinschaft führbar. Er ist vorzeigbar geworden – als Mittel der Politik und als Medium anstelle der Politik.
Denn was sind die Schrecken des Krieges noch für die bequem Zusehenden, wenn sie als martialische Mischung aus Militärshow und Entertainment dargeboten werden? Wesentlich war, dass sich die ganze Sichtweise änderte.
Wie sah der Krieg aus? Wir folgten den Truppen. Punkt für Punkt wurde vom „Vorrücken" der Panzer, vom "Einnehmen" einiger "Stellungen", vom "Einrücken" in Städte berichtet, deren Namen oft ohne jede Not geheimnisvoll gedehnt und schräg betont wurden. Das Schlachtfeld war nicht zu sehen. Aber die Schlachtenbummler ruckelten auf dem Sofa. Sogar als der "Vormarsch" zu "stocken" schien, war es immerhin noch ein Vormarsch. Und die Zuschauer hinten dran. An welchem Punkt "wir" gerade im Fort- Schritt der Kämpfe waren, zeigten uns Computeranimationen. Wie in Video- Spielen stürzte der Zuschauer samt Sessel vom Himmel herab. Erst im rasenden Sturz erkannten wir ein Land, Irak. Dann waren wir im Anfl ug auf die Umrisse einer Stadt, mal Mosul, mal Tikrit oder Bagdad. Dann landeten wir sogar in engen Straßenschluchten, die im Computer zusammengepixelt waren. Der Zuschauer – egal wo – sah diesen Krieg erstmals wie ein „Ego-Shooter". So heißen die weit verbreiteten Software-„Spiele", die aus der Ich-Perspektive das Töten kinderleicht machen. Diese künstliche Bewegung in ein Begebnis hinein, von dem man fern ist und das gerade dadurch noch weniger bewegend ist, verändert auch uns. Es suggeriert, "wir" wären überall und jederzeit „dabei", selbst wenn wir ausdrücklich ausgeschlossen sind. Diese Wahrheit hält länger als alles, was wahrhaftig hätte gezeigt werden können. Auch wenn wir keine "Kämpfe Haus für Haus" sahen, von denen die Berichter stets raunten – "wir" waren doch schon in jenen Straßen! Auch wenn der Kampf ausgespart blieb. "Experten", die ebenso fern waren und sahen, erklärten uns das Ausbleibende als das "schmutzige" Gesicht des Krieges. Als seien tonnenschwere oder radioaktiv "gehärtete" Bomben der Inbegriff des Sauberen.
 So wurden auch wir "Experten". Die Generäle "außer Dienst"" die aus ihrer Freizeit vor die Kameras eilten, brauchten wir bald nur noch, um eine weitere kuriose Betonung eines arabisch klingenden Namens aufzusaugen. Wir kannten ihre stets wiederholten Platitüden sowieso schon auswendig. Wir waren Zeugen dessen, was "wir" nicht sahen, aber das "wir" wie Experten erklären konnten – auch warum wir etwas nicht sehen "durften". Die sogenannten Militär-Experten ersetzten und beglaubigten die Bilder, die uns die Militärs versagt hatten, selbst wenn es sie gar nicht gegeben haben mag. Experten für Frieden kamen ohnehin nicht vor die Kameras. Dafür sind "Sondersendungen" nicht da. So fand vor unseren Augen in "aktuellen" und "zusammenfassenden" Berichten statt, was nie stattfand. So wurden auch wir "Experten". Die Generäle "außer Dienst"" die aus ihrer Freizeit vor die Kameras eilten, brauchten wir bald nur noch, um eine weitere kuriose Betonung eines arabisch klingenden Namens aufzusaugen. Wir kannten ihre stets wiederholten Platitüden sowieso schon auswendig. Wir waren Zeugen dessen, was "wir" nicht sahen, aber das "wir" wie Experten erklären konnten – auch warum wir etwas nicht sehen "durften". Die sogenannten Militär-Experten ersetzten und beglaubigten die Bilder, die uns die Militärs versagt hatten, selbst wenn es sie gar nicht gegeben haben mag. Experten für Frieden kamen ohnehin nicht vor die Kameras. Dafür sind "Sondersendungen" nicht da. So fand vor unseren Augen in "aktuellen" und "zusammenfassenden" Berichten statt, was nie stattfand.
Auch die vielen „Live-Berichte" im deutschen Fernsehen haben nichts vom Krieg erzählt. Da standen Korrespondenten vor Palmen und sprachen halblaut ins Mikrophon. Manchmal sahen sie zum dräuenden Himmel und duckten sich. Manchmal blickten sie scheu zur Seite. Als stünden sie am Rande eines Festaktes zur Eröffnung einer Gartenschau und wollten bloß nicht stören. Als vertrügen Bomben keine lauten Töne. Gesagt haben uns diese Reporter nichts. Wie einst Karl May: Alles so gut wie authentisch Wir erzählten uns am Ende "den Krieg im Irak". In der U-Bahn, im Büro, in der Kneipe. Wie Karl May vom wilden Kurdistan. Nie dagewesen, aber alles so gut wie authentisch. Nie miteinander reden, aber alles gesagt. Die Fernsehzuschauer verteidigten ihren Feldherrenhügel. Auch wenn der Blick über die Ebenen nicht weit gereicht hat. Und wo die Bilder nicht genügten, die nichts zeigten, wurden in den langsameren Druck-Medien auch altbekannte Geschichten als Geschichte wieder erzählt.
 Da war einmal, gleich nach Kriegsbeginn, als der "Vormarsch" bereits stoppte und erste Soldaten unter "freundschaftlichem Feuer" hingemetzelt waren, die "schöne Soldatin" Jessica. "Seit Sonntag wird Jessica (19) vermisst – was tut Saddam dieser schönen Soldatin an", fragte "Bild" gleich am 26.3.03. Es dauerte viele Schlagzeilen, bis "Bild" berichtete: „US-Spezialkommando befreit Jessica Lynch (19) aus Saddams Händen – Gerettet!" (2.4.03) Weit mehr als dreihunderttausend Soldaten stürmten ohne UNO-Mandat durch die Wüste; Saddam galt bereits als untertaucht oder tot. Aber die Gelegenheit, mit eigener Hand eine Neunzehnjährige zu betatschen, würde er gewiss nicht auslassen. Es war zum Früchten. So fand nach Tausenden von Jahren der Kampf um Troja eine kurze, ebenbürtige Wiedererstehung. Nicht die schöne Helena musste von weit gereisten Heeren befreit werden. Auch war sie keine Königstochter oder mit Gott Zeus und Göttin Leda verwandt. Sie war eine der vielen Teenager-Soldaten, die vermutlich mit Video- Spielen groß geworden sind. Doch die Umstände waren ebenso dramatisch wie in der Ilias: "Wilde Schlacht zur Befreiung der schönen US- Soldatin – Jessica lag verletzt unter 11 Leichen." („Bild", 2. 4.03) Tja: "122 Soldaten starben im Irakkrieg – um diese Helden trauert Amerika." (Bild am 15.4.03) Irakische Zivilisten sind eben keine "Helden". Das war der Krieg. Eine turbulente Mischung aus Vergessen und Erinnern, aus Zu- und Übersehen. Die Medien haben dieses Kaleidoskop erstmals perfekt genutzt. Es brauchte gar kein Zensurgeschrei und selbstgefälliges Greinen, keine "Experten", die Bürger zu Nicht-Experten degradierten. Da war einmal, gleich nach Kriegsbeginn, als der "Vormarsch" bereits stoppte und erste Soldaten unter "freundschaftlichem Feuer" hingemetzelt waren, die "schöne Soldatin" Jessica. "Seit Sonntag wird Jessica (19) vermisst – was tut Saddam dieser schönen Soldatin an", fragte "Bild" gleich am 26.3.03. Es dauerte viele Schlagzeilen, bis "Bild" berichtete: „US-Spezialkommando befreit Jessica Lynch (19) aus Saddams Händen – Gerettet!" (2.4.03) Weit mehr als dreihunderttausend Soldaten stürmten ohne UNO-Mandat durch die Wüste; Saddam galt bereits als untertaucht oder tot. Aber die Gelegenheit, mit eigener Hand eine Neunzehnjährige zu betatschen, würde er gewiss nicht auslassen. Es war zum Früchten. So fand nach Tausenden von Jahren der Kampf um Troja eine kurze, ebenbürtige Wiedererstehung. Nicht die schöne Helena musste von weit gereisten Heeren befreit werden. Auch war sie keine Königstochter oder mit Gott Zeus und Göttin Leda verwandt. Sie war eine der vielen Teenager-Soldaten, die vermutlich mit Video- Spielen groß geworden sind. Doch die Umstände waren ebenso dramatisch wie in der Ilias: "Wilde Schlacht zur Befreiung der schönen US- Soldatin – Jessica lag verletzt unter 11 Leichen." („Bild", 2. 4.03) Tja: "122 Soldaten starben im Irakkrieg – um diese Helden trauert Amerika." (Bild am 15.4.03) Irakische Zivilisten sind eben keine "Helden". Das war der Krieg. Eine turbulente Mischung aus Vergessen und Erinnern, aus Zu- und Übersehen. Die Medien haben dieses Kaleidoskop erstmals perfekt genutzt. Es brauchte gar kein Zensurgeschrei und selbstgefälliges Greinen, keine "Experten", die Bürger zu Nicht-Experten degradierten.
Denn es ging längst nicht um Moral. Die "air campaigns" wie die nächtelangen Luftangriffe genannt wurden, hießen im Experten- Jargon auch "moral bombing". Im Gegenteil. Der Krieg brachte uns Frieden. Da schritt, im Öffentlich-Rechtlichen am Ostersonntag 2003, ein Offi zier der "Desert Rats" mit einem geschulterten, großen Holzkreuz durch einen der "Palast- Gärten" Saddams. Er pflanzte es in den Boden. Um ihn beteten tarnfarben Gewandete, von deren Schultern Maschinenpistolen baumelten.
 Was war denn noch gleich der "Krieg", früher, als nicht "live" berichtet wurde? Da waren einmal die Fotos aus Vietnam: Der Polizeichef von Saigon schießt einem Gefangenen in den Kopf. Mädchen rennen schreiend auf einer Straße fort. Ihre Haut auf den nackten Körpern ist zerfetzt. Die Reporter waren dabei. Ihren Schrecken zeigten sie mit den Bildern des Schreckens. Dabei blieb niemand ruhig auf dem Sofa sitzen. Krieg war als Morden zu sehen, nicht als geradezu zwanghaft fabulierte "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln". Was wäre das denn wohl für eine Politik, die sich so "fortsetzte"? Was wären ihre Mittel, wenn das bloß die "anderen" wären? Spätestens mit dem Dritten Golfkrieg ist Alltag geworden, was Kurt Tucholsky sich 1924 vorstellte: Dass zu einem Krieg nicht mehr alle "hingehen". Aber bedrohlich wirkt nun, was der Kabarettist Matthias Beltz vor einigen Jahren mit diesem Ausspruch noch kalauerte: "Stell Dir vor, es ist Krieg – und der Fernseher ist kaputt." Tucholsky hat seine Vorlage 1927 in seinem Aufsatz "Über wirkungsvollen Pazi- fi smus" lediglich als Beginn einer aktiven Mobilisierung statt eines passiven Rückzugs herausgearbeitet: "Da fängt es an. Sich im Kriege zu drücken, wo immer man nur kann – wie ich es getan habe und Hunderte meiner Freunde – ist das Recht des einzelnen. Jubel über militärische Schauspiele ist eine Reklame für den nächsten Krieg; man drehe diesem Kram den Rücken oder bekämpfe ihn aktiv. Auch wohlwollende Zuschauer sind Bestärkung." Was war denn noch gleich der "Krieg", früher, als nicht "live" berichtet wurde? Da waren einmal die Fotos aus Vietnam: Der Polizeichef von Saigon schießt einem Gefangenen in den Kopf. Mädchen rennen schreiend auf einer Straße fort. Ihre Haut auf den nackten Körpern ist zerfetzt. Die Reporter waren dabei. Ihren Schrecken zeigten sie mit den Bildern des Schreckens. Dabei blieb niemand ruhig auf dem Sofa sitzen. Krieg war als Morden zu sehen, nicht als geradezu zwanghaft fabulierte "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln". Was wäre das denn wohl für eine Politik, die sich so "fortsetzte"? Was wären ihre Mittel, wenn das bloß die "anderen" wären? Spätestens mit dem Dritten Golfkrieg ist Alltag geworden, was Kurt Tucholsky sich 1924 vorstellte: Dass zu einem Krieg nicht mehr alle "hingehen". Aber bedrohlich wirkt nun, was der Kabarettist Matthias Beltz vor einigen Jahren mit diesem Ausspruch noch kalauerte: "Stell Dir vor, es ist Krieg – und der Fernseher ist kaputt." Tucholsky hat seine Vorlage 1927 in seinem Aufsatz "Über wirkungsvollen Pazi- fi smus" lediglich als Beginn einer aktiven Mobilisierung statt eines passiven Rückzugs herausgearbeitet: "Da fängt es an. Sich im Kriege zu drücken, wo immer man nur kann – wie ich es getan habe und Hunderte meiner Freunde – ist das Recht des einzelnen. Jubel über militärische Schauspiele ist eine Reklame für den nächsten Krieg; man drehe diesem Kram den Rücken oder bekämpfe ihn aktiv. Auch wohlwollende Zuschauer sind Bestärkung."
(In: Kunst & Kultur, 10. Jahrgang Nr. 4/2003, Stuttgart 2003, S. 13 -14)
Wieder nach oben.
Tod und Theo in der Hölle der Allgegenwart
Von der Notwendigkeit der Öffentlichkeit gegen den Terrorismus
Früher war Durbridge noch spannend. Wenn einer seiner mehrteiligen Krimis im Fernsehen zu sehen war, sah man niemanden mehr auf der Straße. Und wenn Sjöwall/Wahlöö den Kommissar Beck wieder mal eine Tote aus dem Kanal fischen ließen, das Wasserschwappen den Stoff über dem Lautsprecher zu nässen schien und das grüne Magische Auge zuckte – tatsächlich! –, dann versengten beim Bügeln vor dem Radio schon mal die Hemden. Es war zum Fürchten. Anderentags wurde ausgiebig darüber diskutiert.
Wer heute einen dieser Filme sieht oder ein Hörspiel aus den sechziger, siebziger Jahren hört, wird das Kribbeln nicht bekommen und erinnernd kaum mehr verstehen, dass es überhaupt aufkam. Die Durbridge-Dinger wirken heute strunzlangweilig. Was ist geschehen? Haben sich die Geschmäcker so geändert? Sind womöglich die Reize im Fernsehen inzwischen so übergroß, dass früheres Fernsehen oder Radiodokumente heute langweilig scheinen?
Man weiß es nicht. Aber sicher ist, dass es auch niemanden mehr interessiert. Es ist nicht mehr spannend, quasi jedermann auf der Straße ansprechen zu können, wie er denn über den vorangegangenen Fernsehabend denke. Dazu gibt es doch das Handy, damit man gleich die erreicht, die wie erwartet antworten könnten. Man weiß es selber besser und möchte es allenfalls noch bestätigt hören.
Jene alte allgemeine, nicht zielgerichtete Öffentlichkeit, womöglich absonderlicherweise von einem monopolhaften Medium angezettelt, gibt es nicht mehr. Das Publikum ist durch die vielen kleinen Sender zerfallen in viele Publika, die bloß noch "ihren" Talkmaster, wenn überhaupt: "ihren" Moderator hören, "ihre" Sportart oder "ihren" Leibkoch sehen wollen. Die Vielfalt, die früher erst bei den Zuschauern, beim Hörer entstand, ist einer Vielheit bei Zuschauergruppen gewichen, die voneinander nichts wissen – und vor allem: nichts wissen wollen. Erinnern wir uns noch an Harald auf Rügen (jeder wird so seinen "Harald" kennen)? – Den Kopf mit der Wollmütze zum Radio geneigt, glücklich, wenigstens "den Dänen" hineingedreht oder "den Schweden" empfangen zu haben, wenn die Wellen des Deutschlandfunks im Nebel steckengeblieben waren. Harald musste dann reden, kommentieren. Die Bilder von der Lage der Welt in seinem Kopf gehörten ausgebreitet. Harald ist längst tot. Aus dem Radio tönen Oldies, unterbrochen von Gesabber. Dem Wetterbericht und den Staumeldungen wird mehr Zeit eingeräumt als Nachrichten. Die Sonne, der Regen, der Schumacher Michael oder Ralf da, 15 Kilometer Stillstand bei Harburg, hier und sonstwo. Strunzlangweilig.
Und doch sind da einzelne Phänomene wie "Big Brother", Kuppelei-Sendungen wie Blind Dates über die irgendwie "alle" reden, denen irgendwie "viele" zuhören. Außerdem gibt es den noch unbestrittenen, gleichwohl anmaßenden Anspruch auf totale Öffentlichkeit: Wir seien doch eine "Mediengesellschaft", wenn nicht gar eine egalisierende "Mediendemokratie" – beides Begriffe, die so eigenartig kontrastieren mit der weihevollen Rede von der "Info-Elite" und der "Wissensgesellschaft", die sich, bei näherem Hinsehen, immer mehr als Bloß-Schneller-Wissen- und Rasch-Vergessen-Gesellschaft entpuppt.
Haben also die zersplitterten vielen Medien, die nicht einmal ein einendes Abendprogramm zustande bringen, sogar mehr Macht als die öffentlich-rechtlichen Anstalten seinerzeit? Sind die Parteien, die auf die Einschaltquoten schielen, von ihnen abhängiger als die Bürger, die als höchste demokratische Reife rasch wegzappen, wenn ihnen das aufgedrängte Programm nicht mehr gefällt? Gibt es Demokratie per Fernbedienung, wie es die Medien-Fürsten in Deutschland beharrlich behaupten, um sich in neue Kleider zu hüllen?
 Wozu brauchen wir denn da auch noch "Öffentlichkeit" – vor lauter Medien? Früher wurde doch nur um mehr "Öffentlichkeit" gerungen, weil Könige, Kaiser, Fürsten und ihre Hofschranzen dem brav arbeitenden Bürger ihre Mitbestimmung über ihr geschröpftes Geld verwehren wollten, ja, sie sollten gar nicht erst wissen, was und wie die Politik bestimme. Wozu brauchen wir denn da auch noch "Öffentlichkeit" – vor lauter Medien? Früher wurde doch nur um mehr "Öffentlichkeit" gerungen, weil Könige, Kaiser, Fürsten und ihre Hofschranzen dem brav arbeitenden Bürger ihre Mitbestimmung über ihr geschröpftes Geld verwehren wollten, ja, sie sollten gar nicht erst wissen, was und wie die Politik bestimme.
Das ist alles längst vorbei, oder? Andererseits sahen die meisten Fernsehbürger die Einschläge zweier Flugzeuge ins World Trade Center – auf allen Kanälen dieselben Bilder und hörten dieselben Bedeutungsworte, als hätten wir doch noch nur einen oder zwei Monopolsender. Und alsbald
"wussten" fast alle, dass es die "Gotteskrieger" gewesen seien, mit einem "Angriff auf die Zivilisation", also auf uns alle. Wenn nun zum Kreuzzug gerufen wird, "weiß" der Bürger durch die große Öffentlichkeit der vielen Unisono-Medien also besser Bescheid als noch zur Königszeit?
Es scheint nur zu nahe zu liegen, dass dem so ist. Aber ist es nicht merkwürdig, dass etwa Durbridge die Menschen über Tage und Wochen zum Reden brachte, ihre Aufmerksamkeit immer wieder weckte, und der Einsturz der Twin-Towers eine solitäre Medien-Sensation blieb, ein Ereignis zur besten Talkshow-Zeit, das das endlose Ersatzreden kurz innehalten ließ? Wer – außer einigen Politikern – redete schon noch davon, nachdem Ulla Kock am Brink ihrer "besten Freundin", Sabine Christiansen, den Theo genommen hatte?
Die auffällig ähnliche Aufmerksamkeitsintensität, mit der sich beide Medienereignisse wie beim Stafettenlauf abwechselten, wurde von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nur kopfschüttelnd registriert. Vielleicht verbirgt sich in dem trauer- und schamlosen Übergang von Tod und Theo aber mehr als eine Laune der Nachrichtenwelt, die nicht mehr nur am Loch Ness ständig nach Sensationen Ausschau halten kann?
Im Gegenteil: Das Zerfallen der Öffentlichkeit in Teile, die – wieder zusammengesetzt – alles andere als das Ganze ergäben, korrespondiert offenbar mit dem Anwachsen scheinbar sogar weltweiter "Öffentlichkeit" zu einem kurzzeitigen, rasch lustlos an die Seite gestellten Problem. Wenn Hunde Menschen zerfleischen, gibt es erst nach Jahren empörte "Öffentlichkeit", sobald ein türkischer Junge zerrissen wird. Wenn Skins und Nazis Ausländer, Homosexuelle und Heimatlose morden, interessiert es die "Öffentlichkeit" erst, sobald ein kleiner halb-irakischer Junge von einer rassistischen Horde "ersäuft" (Süddeutsche Zeitung) sein worden könnte. Wenn seit Jahrzehnten täglich dreißigtausend Menschen allein an Hunger sterben, die meisten in Afrika, interessiert das, noch nicht einmal, wenn dreitausend Menschen in einstürzenden Neubauten begraben werden.
Afrika ist noch weiter vom Planeten Durbridge entfernt als andere Galaxien der guten Laune und des Unterhaltenseins. Afrika als Kontinent mit Menschen und nicht nur mit possierlichen Affen und Giraffen kommt in den Medien prozentual noch geringer vor als dessen Prozentpunkte an der Weltwirtschaft ausmachen. Immer mehr werden Gefühle von den Medien und ihren Eigentümern so gesteuert; Emotionen sind der Treibstoff und die Fokussierung, der heute die Unterhaltung ersetzt – eine Unterhaltung, die des Gesprächs nicht mehr bedarf, sondern reiner Konsum ist, der nicht nach
der Moral fragt, aber sie vorheuchelt. "Powered by emotion", wirbt SAT.1 für sich. Eine "mission line" sagen Werber zu solcherlei Unterzeile. Das ZDF wirbt auf riesigen Plakatwänden damit, dass bei ihm die "großen Emotionen" besser hör- und sichtbar seien.
Aber ist es nicht mehr als ein bloß theoretisches, sondern ein moralisches oder gar ein politisches Problem, dass "Öffentlichkeit" möglicherweise (wieder) "gebraucht" wird, um ihre bisherigen Errungenschaften wie die parlamentarische, die gesellschaftliche und die kulturelle Demokratie nicht zu gefährden? Und gibt es weniger "Öffentlichkeit", als es scheint?
Mitunter liegt der Mangel doch unbemerkt geradezu im tatsächlich unübersehbaren Überfluss: Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, die Stadt vor lauter Häusern nicht erkennen, die "Mediengesellschaft" vor lauter Fernsehkanälen nicht mehr wahr nehmen können.
Dann ist es gut, wenn man einen Kontrast oder eine andere Relativierung hat – wenn man Maß nimmt. Die Wiese zeigt, wo der Wald beginnt oder endet. Die Stadt erkennt, wer den Himmel über ihr studiert. – So hat Sartre erst die von ihm gehasste Metropole New York begriffen, in der er gleich nach dem Zweiten Weltkrieg der Enge der französischen Provinz zu entfliehen suchte und sich zwischen Beton und Stahl eingesperrt sah. Und die "Mediengesellschaft" lässt sich sowohl aus der Überwindung der Zeitungs- und Meinungsoligopole konturieren als auch andersherum in der Verelendung durch die bramarbasierende Vereinzelung in zahllosen Talkshows.
Maßnehmen – das ist die Kernerarbeit der Künste, nicht nur des Handwerks. Maßnehmen, um dann große Bögen zu schlagen und sicht- und hörbar werden zu lassen, was die gemessene Welt hervorzubringt, statt sie mit Maßlosem vollzustellen.
So war es Ende der siebziger Jahre auch mit dem Wörtchen "Kultur", das scheinbar alle Künste umschloss – und doch nicht hielt, was es versprach. Es grenzte aus statt zu verbinden. Es war keine begriffliche Einheit, sondern diskrete Absonderung mit dem Charme der Bourgeoisie. "Kultur" ließ es wie der "Wald" scheinbar an nichts missen. Doch im Dunkeln der Eichen, half auch kein Pfeifen: Es war eine Monokultur, hoch gewachsen, beeindruckend, stabil, aber nur auf sich selbst bezogen. Erst die Relativierung durch wildwüchsig aufgekommene Vokabeln wie "Sub"- oder "Gegen-Kultur" führte zu weiteren, zielsuchenden Begriffen wie Kultur "von unten" oder "für alle". Durch diesen erweiterten, maßnehmenden Kulturbegriff wurde unvermutet die Stadt anders und besser sichtbar – und trotz aller spöttischer Gegenrede der Traditionalisten von den "Spielwiesen" sogar das Land, im engen und im weiten Sinne. Dass sich unvermutet so viele Perspektiven auftaten, lag nicht nur an der Emphase der offenbar überfälligen Debatte zum traditionellen Kulturbegriff und -verständnis. Es war eben der zugesellte schillernde Begriff der "Öffentlichkeit", der bei nun plötzlich kultivierten "Kultur-Initiativen" selbst kleine Schritte zu Fortschritten machte. Nun stand nämlich das Kulturelle nicht mehr an und für sich da, sondern im Zusammenhang der "Demokratisierung". Denn auch in der Politikwissenschaft setzte sich allmählich während der siebziger Jahre, der Zeit der Bürgerproteste und -initiativen, die Erkenntnis durch, dass der Parlamentarismus – wenn er auf Dauer leistungsstark und mehrheitsfähig bleiben wolle – in einer fein maßnehmenden Trias aus Effizienz, Transparenz und Partizipation sein eigenes Gewicht entwickeln könne, um für die Öffentlichkeit nicht nur ein undurchschaubares Formengeflecht zu bleiben.
Drei Jahrzehnte sind seither vergangen. Wenn heute von "Kulturpolitik" die Rede ist, wird mehr und anderes mitgedacht als seinerzeit. Ist heute von Bürgerprotesten die Rede, geht es schon mal gegen deren grau gewordene Inkarnation, die GRÜNEN. Wir stehen in einem Mischwald, in dem es hier und da Blätter sauer regnet. Die ersehnte und erörterte "Öffentlichkeit" scheint sich in der "Medien-Demokratie" kondensiert oder gar institutionalisiert zu haben. Doch abermals ist ein beruhigter, bewegungsloser Zustand eingetreten, ähnlich dem der fünfziger, sechziger Jahre, was schon deshalb verunsichern sollte. Doch was erzählt uns der Himmel über den Städten, aus dem plötzlich Flugzeuge in Türme gelenkt werden, die ganz verschiedenen Kulturen und Künstlern bis dahin sichere Heimstatt war? Maßnehmen allein hilft anscheinend nicht mehr in der einsturzgefährdeten Auftürmung von Allgegenwärtigem, aber nicht Vergegenwärtigtem, dieser medialen Vorhölle des ewigen Jetzt.
Die New Yorker Künstlerin Nancy Davenport hatte vor dem 11. September 2001 versucht, ihre und andere US-Städte (neu) sehen zu lernen. Anders als Sartre, der seine Perspektiven aus den Maßverhältnissen der Häuser zum Himmel gewann, montierte sie in ihre Fotos von Skylines amerikanischer Großstädte bedrohliche Rauchsäulen ein. Diese Rauchzeichen verstörten oder verstanden nur wenige, in einer kleinen kunstsinnigen Öffentlichkeit. Als Vorahnung sah sie keiner.
Davenports Freund fand im Rauch des World Trade Centers den Tod. Der New Yorker Bildhauer hatte den Menschen und sich zum Maßverhältnis genommen. Seine Körperplastiken zeigen Maschinen, Flugzeuge, die in ihn eindringen und von allen Seiten aufspießen – der leibliche Alptraum der Risikogesellschaft. Kunst nahm Maß, aber sie fand nicht die Öffentlichkeit, die sie wiederum in Bezüge gesetzt hätte.
Mit der "Mediengesellschaft" hat es nämlich eine besondere Bewandtnis: Die Medien können oder wollen gerade all das, was eine Gesellschaft ausmacht, kaum oder gar nicht abbilden, sicht- oder hörbar machen. Es sind allenfalls Surrogate, Ersatzstoffe mit Reizverstärkung, die beliebig eingesetzt werden: Gefühle verkümmern so zu Emotionen, Zukunft verkommt zur Fiction, Liebe gerinnt zu Sex und Schmalz, Gewalt geriert sich als "Unterhaltung", Unterhaltung wird zum Talk. Und Gefahren werden zur Sensation, das Risiko zum Kitzel.
Der Soziologe Ulrich Beck charakterisierte in "Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne" schon 1986, was sich fünfzehn Jahre später am 11. September in New York brutal konkretisierte: "Wo der Überfluss an Risiken den Überfluss an Reichtum bei weitem in den Schatten stellt, gewinnt die scheinbar harmlose Unterscheidung zwischen Risiken und Wahrnehmung der Risiken an Bedeutung."
Wie aber, so ist mit Beck zu fragen, ist der 11. September (der eingetretene Risikofall) in der Öffentlichkeit anders wahr genommen worden, wenn interviewte Betroffene nicht gleich in die Mikrophone schluchzten, sie hätten das Gesehene zuerst "für Science Fiction" und "Hollywood" gehalten? Wie denn wurde das Risiko davon unterschieden? – Es sei ein Anschlag auf "unsere Zivilisation" gewesen, ordneten Staatsmänner sofort die Welt. Hat man erst einen Feind, ist der Tag schon strukturiert. Es seien wohl "Gotteskrieger", die ihren religiösen Fanatismus gegen "unsere Kultur" richteten. Aber bis heute können wir nicht klar benennen, was eigentlich über die vielen Toten hinaus gewaltsam von uns gerissen wurde – und worin künftig die Risiken für "unsere Kultur" liegen. Eher könnte durch die verständliche, aber maßlose Sicherheitshysterie die Demokratie leiden, wenn sich nach "den Anschlägen" die Risiko-Gesellschaft statt der Medien-Gesellschaft zum alleinigen, ängstlichen Maßstab der Alltagskultur verselbständigen würde.
Es ist bei allen aktuellen Vorgängen nur zu absonderlich, dass die Wahr-Nehmung des Ereignisses anfangs als konstante, in Echtzeit fließende Bildfolge zu uns kam, als mörderischer Endpunkt einer Medien-Entwicklung. Denn in diesem Augen-Blick sah nicht "die Öffentlichkeit" das ungeheuerliche Verbrechen, Vereinzelte sahen es, denen in ihren vier Wänden nur der Blick in Kanäle blieb, die sich ebenso schnell aus der Ursache wie nachhaltig in der Wirkung auf einen Sender verengten: auf CNN.
Bizarr ist dieser Umstand auch dadurch, dass die terroristischen Anschläge, ihre Vorbereitung wie auch die Durchführung, ein bewusstes Gegenbild zu jeder verfassten demokratischen Öffentlichkeit sind: Sie werden geheim, nicht-öffentlich vorbereitet, um durch die Überraschung ihrer Öffentlichmachung absurderweise eine größtmögliche Öffentlichkeit zu erreichen.
Dieses Paradoxon und ihre atemlose, monitorial verengende und doppelsinnig zerfallende Wahrnehmung vorerst nur über elektronische Medien fordert – nicht nur wegen der gemutmaßten Gegnerschaft der "Angreifer" – die Kultur der "Angegriffenen" heraus, auf allen Ebenen, in allen Facetten.
Doch wie sind wir dafür gerüstet außer mit Fernsehern in jeder Ecke, mit Radiogedudel und Internet? Wie sind wir gerüstet, nachdem "Öffentlichkeit" und "Demokratisierung" in den neunziger Jahren kaum mehr Themen waren und wir glaubten, die gesellschaftliche und persönliche Selbstvergewisserung durch Kultur könne niemand mehr stören?
Gewiß, Richard Sennett hatte schon 1974 warnend die Studie "The Fall of Public Man" vorgelegt, die aber erst 1983 in Deutschland unter dem Titel "Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität" erschien. Beachtet hat deren tiefgreifende Bedeutung kaum jemand, zumal die geschilderte Erosion des Öffentlichen vor allem durch die Medien wie ein Implosionsprozess in unser nach außen gekehrtes Innerstes wirkt. – Ein Knall auf allen Kanälen, begleitet von der irritierenden Fragmentierung der Lebens- und Arbeitsbereiche. Wir können nicht mehr einfach so darüber reden, wie wir es mit dem Kampfbegriff der "Öffentlichkeit" vor drei Jahrzehnten noch praktizierten. Es fehlen die Instrumente und Institutionen, aber auch die Einübung und der Willen.
Es gibt dazu in Deutschland noch dazu wenige übergreifende, gesamt-gesellschaftliche Analysen, die die Dialektik von Kultur und "Sozio-Kultur", von Demokratie und Öffentlichkeit, von Medien und Individualität, von vermeintlichem Realitätssinn und Risikoausblendung umfassen – und dies sogar in ihrer Entwicklung über die Jahrzehnte, die wir mehr oder weniger interessiert begleiten konnten.
Glücklicherweise haben die beiden Philosophen Alexander Klug und Oskar Negt Bilanz gezogen, weil Kluge gerade siebzig und die gemeinsame Arbeit dreißig Jahre "alt" wurde, aber jünger denn je da steht.
Vor drei Jahrzehnten veröffentlichten der Soziologe Oskar Negt und der Filmemacher Alexander Kluge "Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit". Im vergangenen Herbst wurde ihre "gemeinsame Philosophie", in zwei Bände gefasst, als "Der unterschätzte Mensch" (Zweitausendeins, Frankfurt/Main) herausgegeben. Dazwischen lag eine Reihe präzisierender oder weiterführender Studien und Thesen, die sich nicht nur für die kulturpolitische wie auch die demokratie-schützende Diskussion zu vergegenwärtigen lohnt. Es erzählt auch viel darüber, wie wir die vergangenen Jahrzehnte haben verstreichen lassen mit faulen Disputen um unseren im rasend wachsenden Reichtum gefährdeten Wohlstand und die Selbstbedienungsmentalität in einer "Dienstleistungsgesellschaft". Und es ist eben dort bereits eine Lücke kenntlich, die nicht erst Jets in Skyscraper schlagen mussten – in der kaum mehr öffentlich erörterten Art, wie "zivilisiert" unser Leben geführt wurde, ähnlich organisiert den Kassenbüchern.
Als eine Art Jahrzehntbilanz kann inzwischen die gemeinsame Veröffentlichung "Geschichte und Eigensinn" (1981) verstanden werden (die in Band 2 der Kompilation neu aufgelegt wurde) zusammen mit Negts "Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen" (1981) und Kluges Kompendium "Die Macht der Gefühle" (1984) sowie die virtuose "Chronik der Gefühle" (2000).
Alle Veröffentlichungen haben direkt und indirekt das kulturelle Gelände nicht nur in Deutschland, sondern in dem Kontext arrondiert, der heute fälschlich als "unsere Zivilisation" verkürzt wird. Sie sind nicht nur wissenschaftlich akribische Beobachtungen, sondern auch teils Brikolage, die in der Kombination den verstellten Blick anders weitet als fliegende Selbstmord-Bomben oder die als Vergeltung per Fernbedienung "antwortenden" Bomben.
Bei Negt und Kluge geht es keinesfalls nur demokratie-kritisch bemängelnd um die bedrohlichen Auflösungserscheinungen, wie dies Jürgen Habermas schon 1962 im "Strukturwandel der Öffentlichkeit" als Bereicherung der Protestbewegungen analysiert und 1985 an Beispielen in "Die Neue Unübersichtlichkeit" ein wenig resignierend konkretisiert hatte. So wird in "Öffentlichkeit und Erfahrung" und insbesondere in "Maßverhältnisse des Politischen. 15 Vorschläge zum Unterscheidungsvermögen" (1992) – beide nun in der Sammlung nachzulesen – bereits vor der allmählichen Deformation klassischer Politikfelder und -handlungsweisen sowie zur Identitätsbildung in der Gesellschaft ähnlich gewarnt wie bei Sennett und Habermas, die aus verschiedenen Betrachtungswinkeln doch beide zu dem Punkt kommen: Dass die schwindende, alle gesellschaftlichen Ebenen gleichermaßen strukturierende "Öffentlichkeit" kaum ersetzbar sein würde.
Doch es gibt auch grundlegende Kritik an den wegweisenden Konzepten, die Kluge und Negt vertreten: Es sind teils Ideengebäude und Gedankenschulen, die dem Alltag der späten Moderne, die sich bewusst vor-mittelalterlichen Stammesgesellschaften "gegenüber" sieht, nicht gerecht werden. Es ist eine teils verbrämten Moderne, in der abermals kulturelle Überlegenheitsgefühle und Hass die öffentliche Diktion und auch das nicht-öffentliche Denken der Politiker und Militärs dominieren.
Negt und Kluge lassen sich nämlich von Hoffnungen leiten, in der angenommenen, aber unbegründbaren "Unterschätzung" des Menschen lägen Potentiale, oder verborgene grundlegende Chiffren, die über die Wechsellaunen der Geschichte hinweg der Menschheit erhalten blieben: beispielsweise in den mythologischen Erzählungen der Antike oder den Opernstoffen der vergangenen drei Jahrhunderte. Da lockt wieder der Wald.
Das Beispielhafte muss nur zu oft als Beleg herhalten. Aber das Belegte ist oft auch beispielhaft für die beschriebenen Strukturen der Auflösung von Öffentlichkeit, insbesondere durch die andere Rolle und Funktion der Arbeit in globalisierten und fragmentierten Zuständen und mehr noch in Zeiten zunehmender Arbeitslosigkeit, die – wahrscheinlich dauernd prägender als die Arbeit – Individuen entfremdet. Oskar Negt verheddert sich da – augenfällig seiner neuesten Streitschrift "Arbeit und menschliche Würde (Steidl, Göttingen) – in seiner ansonsten wohltuenden, aber kritischen Nähe zur
Gewerkschaft, in seinem sozialen Engagement, das über die Arbeitswelt hinaus zu wenig in die Arbeitslosenwelt eindringt.
Es ist eine ungeahnte Ironie des Gedankenkreisens, dass offenbar die Diskussion um die Öffnung des Kulturbegriffs der beiden Autoren – auch ohne die Ereignisse vom 11. September 2001 – an ihren Ausgangspunkt der siebziger Jahre zurückgekehrt ist. Ausgerechnet Negt, der mit seiner Initiative und seinen Veröffentlichungen zu einer alternativen Pädagogik in der "Glocksee-Schule" in Hannover einem emanzipatorischen Ansatz folgte, der tradierte bürgerliche und gesellschaftlich ab- und verschließende Codes abschaffen wollte, singt nun mit Kluge das hohe Lied der Opernhelden. Ausgerechnet Kluge, der in seinen jahrzehntelangen Erprobungen des Mediums Film und mittels seines vorbildhaft Bilder zerstörenden Anti-Fernsehens "Ten to Eleven" neue Wahrnehmungen ermöglichte, zieht sich auf das Anachronistische zurück, das im Anekdotischen und Ausgedachten seiner "Chronik" als "Gefühle" zu schlummern scheint.
Schlimm: Wie nämlich können wir angesichts der schamlosen Echtzeit-Schleifen der Nachrichten-Blöcke mit den Einschlag-Aufnahmen der Flugzeuge, angesichts dieses "Angriffs der Gegenwart auf die übrige Zeit" (wie Kluge es noch vor Jahren im Auge hatte), wie können wir da noch vor lauter beharrlich zelebriertem Jetzt in die Zukunft sehen? Der 11. September 2001 hat doch vor allem "spüren" lassen (und zwar so wenig wie möglich), dass ganze Kontinente wie Afrika von der "Öffentlichkeit" so gut wie ausgeschlossen sind und andere Weltregionen wie West-Asien nur in den Blick geraten, wenn es einen unmittelbaren Bezug zur Nabelschau hat. Zu den Folgen, einem kaum kontrollierten und kontrollierbaren Krieg, sickern die Nachrichten über ein halbes Jahr nach dem "Tag Null" dementsprechend nur spärlich. Man erfährt mehr über Uschi oder den Spielfilmmogul Kirch. Jetzt – nach dem Angriff auf die Öffentlichkeit – jetzt, da Öffentlichkeit Not täte, fehlt sie, aber nicht als Folge, sondern als Symptom. Jetzt, wo über die Strukturen der Nicht-Öffentlichkeit nachzudenken wäre, handeln die wenigen vorliegenden Entwürfe ausgerechnet von einem Öffentlichkeitsbegriff, der elitär und verstaubt ist, der anknüpft an alte "Kultur"-Verständnisse mit Äußerungsformen, die bei allem guten Willen kaum mehr als zeitgenössisch und gar zeitgemäß anzusehen wären. Jetzt, da Gegen-Öffentlichkeit mehr als eine ungenaue Beschreibungskategorie sein müsste, wird von "Erfahrung" und "Bedeutung" geredet als hätten wir auf einmal alle Zeit der Welt.
Doch die allmählich, nicht zuletzt wegen der anmaßenden Zensur wieder aufkommende Debatte um einen Öffentlichkeitsbegriff kann sich angesichts der Ereignisse nicht mehr festmachen lassen an den alltäglichen Malaisen des politischen Systems von der "K-Frage" bis zum "Otto-Katalog" oder den Banalitäten des Medien-Einerleis zwischen Talk- und Quizshows, schon gar nicht von der Entkoppelung ganzer Bevölkerungsgruppen beispielsweise wie der Arbeitslosen von der Überstunden häufelnden Gesellschaft. Und sie kann nicht in bemühten Metaphern oder Mythen Allegorien entwickeln, die eher eskapistisch, denn der Zukunft zugewandt sind.
Oskar Negt und Alexander Kluge ließen sich jüngst in der Evangelischen Akademie Loccum in ihrem Lebenswerk besichtigen als wären sie bereits Relikte aus vergangener Zeit, die ihre Einrede für die Gegenwart unwahrscheinlich machte. "Strukturwandel der Öffentlichkeit" war die Tagung ursprünglich annonciert und dann gefälliger in "Maßverhältnisse des Politischen" umgetextet worden, in der Unterzeile für "Öffentlichkeit und Erfahrung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert" für die Veranstaltung werbend. Da war dann häufig von der Odyssee und von Ovid die Rede und auch von der Macht der Bürokratie und von der sinnstiftenden Welt der Oper.
Deshalb tut diese Nachrede Not auf eine Epoche angeregter Gespräche, die wir in den siebziger Jahren nicht zu Ende geführt haben, weil wir dachten, es würde "nur" Kulturpolitik, allenfalls noch um "Gesellschaftsveränderung" per "Marsch durch die Institutionen" gehen können – statt um den Kern unserer Gesellschaft.
Es geht auch heute um mehr. Im "Krieg gegen den Terrorismus" geht es um alles. Es geht nicht um den Sieg über Terroristen, sondern den Sieg der Demokraten mit ihren Mitteln, nicht denen der Militärs und der Mörder. Es gilt nicht, einen "Krieg" zu gewinnen, sondern die Demokratie. Wir hören auf die beschwörende Formel von selbsternannten Weltpolitikern, dass wir "weiter machen" sollten wie immer, um "den Terroristen" keine Genugtuung zu geben. Dabei machen wir "weiter" als sei nichts geschehen und sollten erkennen, dass wir nicht einmal das weitermachen können, als "es" noch nicht geschehen war. Die Öffentlichkeit ist dafür der Raum. Und sein Inhalt. Was wäre, wenn die Gotteskrieger auf Fronturlaub sind, wenn sie wieder bei uns wohnen und schlafen, mit uns studieren oder kochen? Wie und wohin werden "unsere" Kreuzzügler im Namen der Religion der Allgegenwart zurückkehren, wenn die Öffentlichkeit verschwunden ist?
(In: Kunst & Kultur, 10. Jahrgang Nr. 2/2003, Stuttgart 2003, S. 17 -18)
|

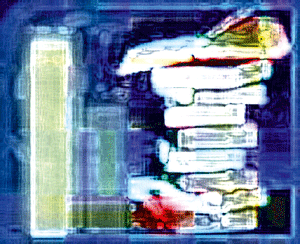 Aus-Zeiten
Aus-Zeiten Hier können Sie redigierte und teils gekürzte Fassungen ursprünglicher Vorträge einmal nachlesen. Es sind drei Texte in engem thematischen Zusammenhang - nämlich, was eigentlich konkret unter der "Ökonomie der Öffentlichkeit " zu verstehen ist, von der Medienmacher so gerne reden.
Hier können Sie redigierte und teils gekürzte Fassungen ursprünglicher Vorträge einmal nachlesen. Es sind drei Texte in engem thematischen Zusammenhang - nämlich, was eigentlich konkret unter der "Ökonomie der Öffentlichkeit " zu verstehen ist, von der Medienmacher so gerne reden. Seit dem 11. September 2001 ist das Erzählen schwerer geworden.
Seit dem 11. September 2001 ist das Erzählen schwerer geworden.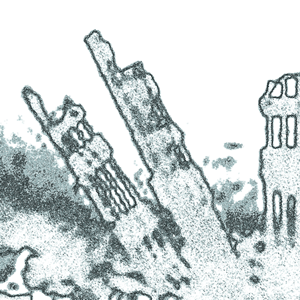 Sie sind auch kein Surrogat mehr für verloren gegangenen Sinn oder gar wie Lego-Bausteine zu einer "neuen" Weltordnung, so wie es Uwe Pörksen mit seinen "Plastikwörtern" als "Sprache einer internationalen Diktatur" prognostizierte. Nein, sie fügen sich nicht einmal mehr zu einem gängigen "Jargon der Eigentlichkeit", den Theodor W. Adorno nach den letzten Kriegen bei den Deutschen erkannte.
Sie sind auch kein Surrogat mehr für verloren gegangenen Sinn oder gar wie Lego-Bausteine zu einer "neuen" Weltordnung, so wie es Uwe Pörksen mit seinen "Plastikwörtern" als "Sprache einer internationalen Diktatur" prognostizierte. Nein, sie fügen sich nicht einmal mehr zu einem gängigen "Jargon der Eigentlichkeit", den Theodor W. Adorno nach den letzten Kriegen bei den Deutschen erkannte. Nichts ist mehr, wie es wahr war, weil die Sicht auf Wirklichkeit nicht durch die Anschläge, sondern durch ihre nachträgliche Deutung verschoben wurde - weil sie anders, nämlich inszenierter, gesehen wurden, als sie in ihrer widerwärtig grobschlächtigen Art waren. Es war kein "Kunstwerk", wie es der quälerische Dirigent Karl-Heinz Stockhausen stilisierte. Und es war auch nicht, was ein deutscher General (der erste, der eine NATO-Mission bei Auslandseinsätzen befehligt) meinte: Er habe die Bilder vom Sturz der Flugzeuge ins World Trade Center zunächst "für Science Fiction gehalten". Arme Ermordete. Ihr Tod als Kompositionsteil oder Komparsenschicksal. Aber es ist weder "science", auch wenn einige der Terroristen mutmaßlich Naturwissenschaften studierten. Noch ist es Fiktion, sondern elende Wirklichkeit. Wäre diese Story der Anschläge nämlich als fiktiver Thriller in Drehbuchform angeboten worden - jeder Produzent und erst recht die behäbigen Redakteure hätten sich krumm gelacht. Da sollen Studenten aus Hamburg-Harburg Flugstunden nehmen und danach mit entführten Passagiermaschinen Hochhäuser rammen? Völlig absurd. Solche Scheiße würde keiner sehen wollen.
Nichts ist mehr, wie es wahr war, weil die Sicht auf Wirklichkeit nicht durch die Anschläge, sondern durch ihre nachträgliche Deutung verschoben wurde - weil sie anders, nämlich inszenierter, gesehen wurden, als sie in ihrer widerwärtig grobschlächtigen Art waren. Es war kein "Kunstwerk", wie es der quälerische Dirigent Karl-Heinz Stockhausen stilisierte. Und es war auch nicht, was ein deutscher General (der erste, der eine NATO-Mission bei Auslandseinsätzen befehligt) meinte: Er habe die Bilder vom Sturz der Flugzeuge ins World Trade Center zunächst "für Science Fiction gehalten". Arme Ermordete. Ihr Tod als Kompositionsteil oder Komparsenschicksal. Aber es ist weder "science", auch wenn einige der Terroristen mutmaßlich Naturwissenschaften studierten. Noch ist es Fiktion, sondern elende Wirklichkeit. Wäre diese Story der Anschläge nämlich als fiktiver Thriller in Drehbuchform angeboten worden - jeder Produzent und erst recht die behäbigen Redakteure hätten sich krumm gelacht. Da sollen Studenten aus Hamburg-Harburg Flugstunden nehmen und danach mit entführten Passagiermaschinen Hochhäuser rammen? Völlig absurd. Solche Scheiße würde keiner sehen wollen. Das war also der Krieg? Wieder einer, den man schon lange kommen sah.
Das war also der Krieg? Wieder einer, den man schon lange kommen sah. Als ginge es im Krieg um Wahrheit! Als würden Bomben nicht Menschen töten, sondern Worte und Bilder. Es ist alles Lüge. Aber anders als wir es erklärt bekommen haben. Wir selbst sind Teil der Lüge.
Als ginge es im Krieg um Wahrheit! Als würden Bomben nicht Menschen töten, sondern Worte und Bilder. Es ist alles Lüge. Aber anders als wir es erklärt bekommen haben. Wir selbst sind Teil der Lüge. So wurden auch wir "Experten". Die Generäle "außer Dienst"" die aus ihrer Freizeit vor die Kameras eilten, brauchten wir bald nur noch, um eine weitere kuriose Betonung eines arabisch klingenden Namens aufzusaugen. Wir kannten ihre stets wiederholten Platitüden sowieso schon auswendig. Wir waren Zeugen dessen, was "wir" nicht sahen, aber das "wir" wie Experten erklären konnten – auch warum wir etwas nicht sehen "durften". Die sogenannten Militär-Experten ersetzten und beglaubigten die Bilder, die uns die Militärs versagt hatten, selbst wenn es sie gar nicht gegeben haben mag. Experten für Frieden kamen ohnehin nicht vor die Kameras. Dafür sind "Sondersendungen" nicht da. So fand vor unseren Augen in "aktuellen" und "zusammenfassenden" Berichten statt, was nie stattfand.
So wurden auch wir "Experten". Die Generäle "außer Dienst"" die aus ihrer Freizeit vor die Kameras eilten, brauchten wir bald nur noch, um eine weitere kuriose Betonung eines arabisch klingenden Namens aufzusaugen. Wir kannten ihre stets wiederholten Platitüden sowieso schon auswendig. Wir waren Zeugen dessen, was "wir" nicht sahen, aber das "wir" wie Experten erklären konnten – auch warum wir etwas nicht sehen "durften". Die sogenannten Militär-Experten ersetzten und beglaubigten die Bilder, die uns die Militärs versagt hatten, selbst wenn es sie gar nicht gegeben haben mag. Experten für Frieden kamen ohnehin nicht vor die Kameras. Dafür sind "Sondersendungen" nicht da. So fand vor unseren Augen in "aktuellen" und "zusammenfassenden" Berichten statt, was nie stattfand. Da war einmal, gleich nach Kriegsbeginn, als der "Vormarsch" bereits stoppte und erste Soldaten unter "freundschaftlichem Feuer" hingemetzelt waren, die "schöne Soldatin" Jessica. "Seit Sonntag wird Jessica (19) vermisst – was tut Saddam dieser schönen Soldatin an", fragte "Bild" gleich am 26.3.03. Es dauerte viele Schlagzeilen, bis "Bild" berichtete: „US-Spezialkommando befreit Jessica Lynch (19) aus Saddams Händen – Gerettet!" (2.4.03) Weit mehr als dreihunderttausend Soldaten stürmten ohne UNO-Mandat durch die Wüste; Saddam galt bereits als untertaucht oder tot. Aber die Gelegenheit, mit eigener Hand eine Neunzehnjährige zu betatschen, würde er gewiss nicht auslassen. Es war zum Früchten. So fand nach Tausenden von Jahren der Kampf um Troja eine kurze, ebenbürtige Wiedererstehung. Nicht die schöne Helena musste von weit gereisten Heeren befreit werden. Auch war sie keine Königstochter oder mit Gott Zeus und Göttin Leda verwandt. Sie war eine der vielen Teenager-Soldaten, die vermutlich mit Video- Spielen groß geworden sind. Doch die Umstände waren ebenso dramatisch wie in der Ilias: "Wilde Schlacht zur Befreiung der schönen US- Soldatin – Jessica lag verletzt unter 11 Leichen." („Bild", 2. 4.03) Tja: "122 Soldaten starben im Irakkrieg – um diese Helden trauert Amerika." (Bild am 15.4.03) Irakische Zivilisten sind eben keine "Helden". Das war der Krieg. Eine turbulente Mischung aus Vergessen und Erinnern, aus Zu- und Übersehen. Die Medien haben dieses Kaleidoskop erstmals perfekt genutzt. Es brauchte gar kein Zensurgeschrei und selbstgefälliges Greinen, keine "Experten", die Bürger zu Nicht-Experten degradierten.
Da war einmal, gleich nach Kriegsbeginn, als der "Vormarsch" bereits stoppte und erste Soldaten unter "freundschaftlichem Feuer" hingemetzelt waren, die "schöne Soldatin" Jessica. "Seit Sonntag wird Jessica (19) vermisst – was tut Saddam dieser schönen Soldatin an", fragte "Bild" gleich am 26.3.03. Es dauerte viele Schlagzeilen, bis "Bild" berichtete: „US-Spezialkommando befreit Jessica Lynch (19) aus Saddams Händen – Gerettet!" (2.4.03) Weit mehr als dreihunderttausend Soldaten stürmten ohne UNO-Mandat durch die Wüste; Saddam galt bereits als untertaucht oder tot. Aber die Gelegenheit, mit eigener Hand eine Neunzehnjährige zu betatschen, würde er gewiss nicht auslassen. Es war zum Früchten. So fand nach Tausenden von Jahren der Kampf um Troja eine kurze, ebenbürtige Wiedererstehung. Nicht die schöne Helena musste von weit gereisten Heeren befreit werden. Auch war sie keine Königstochter oder mit Gott Zeus und Göttin Leda verwandt. Sie war eine der vielen Teenager-Soldaten, die vermutlich mit Video- Spielen groß geworden sind. Doch die Umstände waren ebenso dramatisch wie in der Ilias: "Wilde Schlacht zur Befreiung der schönen US- Soldatin – Jessica lag verletzt unter 11 Leichen." („Bild", 2. 4.03) Tja: "122 Soldaten starben im Irakkrieg – um diese Helden trauert Amerika." (Bild am 15.4.03) Irakische Zivilisten sind eben keine "Helden". Das war der Krieg. Eine turbulente Mischung aus Vergessen und Erinnern, aus Zu- und Übersehen. Die Medien haben dieses Kaleidoskop erstmals perfekt genutzt. Es brauchte gar kein Zensurgeschrei und selbstgefälliges Greinen, keine "Experten", die Bürger zu Nicht-Experten degradierten. Was war denn noch gleich der "Krieg", früher, als nicht "live" berichtet wurde? Da waren einmal die Fotos aus Vietnam: Der Polizeichef von Saigon schießt einem Gefangenen in den Kopf. Mädchen rennen schreiend auf einer Straße fort. Ihre Haut auf den nackten Körpern ist zerfetzt. Die Reporter waren dabei. Ihren Schrecken zeigten sie mit den Bildern des Schreckens. Dabei blieb niemand ruhig auf dem Sofa sitzen. Krieg war als Morden zu sehen, nicht als geradezu zwanghaft fabulierte "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln". Was wäre das denn wohl für eine Politik, die sich so "fortsetzte"? Was wären ihre Mittel, wenn das bloß die "anderen" wären? Spätestens mit dem Dritten Golfkrieg ist Alltag geworden, was Kurt Tucholsky sich 1924 vorstellte: Dass zu einem Krieg nicht mehr alle "hingehen". Aber bedrohlich wirkt nun, was der Kabarettist Matthias Beltz vor einigen Jahren mit diesem Ausspruch noch kalauerte: "Stell Dir vor, es ist Krieg – und der Fernseher ist kaputt." Tucholsky hat seine Vorlage 1927 in seinem Aufsatz "Über wirkungsvollen Pazi- fi smus" lediglich als Beginn einer aktiven Mobilisierung statt eines passiven Rückzugs herausgearbeitet: "Da fängt es an. Sich im Kriege zu drücken, wo immer man nur kann – wie ich es getan habe und Hunderte meiner Freunde – ist das Recht des einzelnen. Jubel über militärische Schauspiele ist eine Reklame für den nächsten Krieg; man drehe diesem Kram den Rücken oder bekämpfe ihn aktiv. Auch wohlwollende Zuschauer sind Bestärkung."
Was war denn noch gleich der "Krieg", früher, als nicht "live" berichtet wurde? Da waren einmal die Fotos aus Vietnam: Der Polizeichef von Saigon schießt einem Gefangenen in den Kopf. Mädchen rennen schreiend auf einer Straße fort. Ihre Haut auf den nackten Körpern ist zerfetzt. Die Reporter waren dabei. Ihren Schrecken zeigten sie mit den Bildern des Schreckens. Dabei blieb niemand ruhig auf dem Sofa sitzen. Krieg war als Morden zu sehen, nicht als geradezu zwanghaft fabulierte "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln". Was wäre das denn wohl für eine Politik, die sich so "fortsetzte"? Was wären ihre Mittel, wenn das bloß die "anderen" wären? Spätestens mit dem Dritten Golfkrieg ist Alltag geworden, was Kurt Tucholsky sich 1924 vorstellte: Dass zu einem Krieg nicht mehr alle "hingehen". Aber bedrohlich wirkt nun, was der Kabarettist Matthias Beltz vor einigen Jahren mit diesem Ausspruch noch kalauerte: "Stell Dir vor, es ist Krieg – und der Fernseher ist kaputt." Tucholsky hat seine Vorlage 1927 in seinem Aufsatz "Über wirkungsvollen Pazi- fi smus" lediglich als Beginn einer aktiven Mobilisierung statt eines passiven Rückzugs herausgearbeitet: "Da fängt es an. Sich im Kriege zu drücken, wo immer man nur kann – wie ich es getan habe und Hunderte meiner Freunde – ist das Recht des einzelnen. Jubel über militärische Schauspiele ist eine Reklame für den nächsten Krieg; man drehe diesem Kram den Rücken oder bekämpfe ihn aktiv. Auch wohlwollende Zuschauer sind Bestärkung."